Der US-amerikanische Moralphilosoph Michael J. Sandel erklärt sich in seinem Buch "Vom Ende des Gemeinwohls" den Niedergang des gesellschaftlichen Zusammenhalts durch die Dominanz des Leistungsprinzips. Auch wenn er berechtigt diverse Fehlentwicklungen anspricht, macht er es sich mit dieser Fixierung auf einen Ursachenfaktor zu einfach, noch andere ökonomische Strukturen dürften entscheidender im Wirkungskontext sein.
"Dies ist ein Land", so US-Präsident Obama in einer Radioansprache 2012, "in dem Sie, wie immer Sie auch aussehen oder woher Sie kommen, so weit vorankommen können, wie Ihre Talente sie tragen, sofern Sie bereit sind zu lernen und hart zu arbeiten. Sie können es schaffen, wenn Sie sich darum bemühen." Doch trifft diese Einschätzung in der sozialen Realität wirklich zu?
Gewiss mag es auch Millionäre geben, die als sprichwörtliche Tellerwäscher angefangen haben. Doch meist kommt es eben nicht zu solchen Entwicklungen. Es gibt auch noch einen anderen Einwand gegen die zitierten Positionen. Wenn dem so in der gesellschaftlichen Wirklichkeit wäre, dann wären die hier Anderen faul und passiv gewesen. Dass eine solche Denkungsart dann bei nicht Wenigen zu Verbitterung führt, treibt sie mitunter den Populisten als potentielle Wählerschaft zu. Von einer solchen Annahme geht der US-Philosoph Michael J. Sandel aus. Sein neues Buch heißt "The Tyranny of Merit", in deutscher Übersetzung: "Vom Ende des Gemeinwohls".
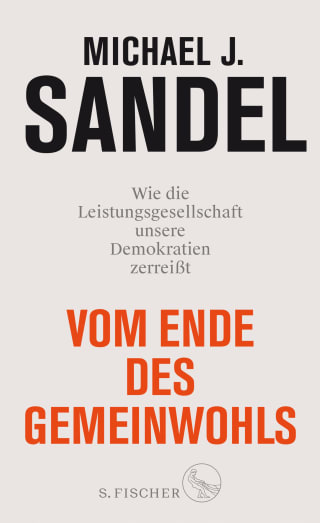
Seine Hauptthese wird im Originaltitel besser veranschaulicht. Der in Harvard lehrende, weltweit bekannte Moralphilosoph wendet sich darin gegen ein aus seiner Sicht zentrales Übel: "die meritokratische Ethik" oder einfacher formuliert: "das Leistungsdenken". Dessen Entwicklung habe letztendlich die gesellschaftliche Solidarität zerstört. Und so erklärt er sich auch die politischen Entfremdungen von den liberalen Ordnungssystemen. Deren Eliten hätten sich von der Mehrheit abgesetzt, denn diese wäre aus eigener Anstrengung nicht zu einem solchen Erfolg fähig gewesen. Eine damit einhergehende Differenzierung von Gewinnern und Verlierern habe politische Wirkungen, die einerseits in der Auflösung von Gemeinwohl und Solidarität und andererseits in der Hinwendung zu Populisten und Verführern bestünde. Marktfreundliche Globalisierung und technokratische Herrschaft hätten den damit gemeinten Prozess noch verschärft. Der Autor schildert diese Entwicklung anhand der jüngeren Geschichte der USA, wo es ein religiös geprägtes Narrativ dazu gebe.
Inhaltlich zugespitzt heißt es: "In einer Leistungsgesellschaft kommt es vor allem darauf an, dass alle die gleiche Chance haben, auf der Erfolgsleiter in die Höhe zu klettern; zu der Frage, wie groß der Abstand zwischen den Sprossen sein sollte, hat sie nichts zu sagen. Das meritokratische Ideal ist kein Mittel gegen Ungleichheit, sondern eine Rechtfertigung von Ungleichheit" (S. 195). Letztere gebe es insbesondere zwischen Akademikern und Nicht-Akademikern in den USA. Diese Auffassung erklärt auch, warum Sandel bezogen auf Universitätszugänge konkrete Vorschläge macht. Sie laufen etwa auf ein Lotterieverfahren für Studienplätze hinaus. Außerdem müsste einfache Arbeit wieder stärker soziale Wertschätzung erfahren: "Nur eine politische Agenda, die diese Ungerechtigkeit anerkennt und sich darum bemüht, die Würde der Arbeit wiederherzustellen, kann wirkungsvoll auf die Unzufriedenheit eingehen, die unsere Politik aufwühlt" (S. 330). Denn das meritokratische Denken führe nicht zu sozialer Demut, sondern den weniger Erfolgreichen gegenüber eher zur Verachtung.
Berechtigt wird von dem Autor die gesellschaftliche Spaltung nicht nur in den USA gesehen. Er verweist auch auf die ansteigende soziale Ungleichheit, welche tatsächlich mit demokratiegefährdenden Wirkungen einhergehen kann. Insofern hat man es mit einem beachtenswerten Problemaufriss zu tun. Gleichwohl wird die Oberfläche von Phänomen von Sandel nur selten durchstoßen. Denn die beklagten Gegebenheiten haben etwas mit ökonomischen Strukturen zu tun, welche von ihm durch das ganze Buch hindurch nicht als Problemfaktor thematisiert werden. Er kritisiert das Leistungsdenken, indessen hat man es aber gerade nicht mit einer Leistungsgesellschaft zu tun. Dies machen die vielen Beispiele und Daten von Sandel selbst deutlich. Bedeutsamer ist die besondere gesellschaftliche Ausgangssituation, eben der starken sozialen Unterschiede. An diesen werden die von dem Autor eingeforderten Wertschätzungen nichts ändern. Insofern hat man es mit einer einseitigen Blickrichtung zu tun; nicht das Leistungsdenken ist das zentrale Problem.
Michael J. Sandel, Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt, Frankfurt/M. 2020 (S. Fischer-Verlag), 442 Seiten, 25 Euro









6 Kommentare
Kommentare
A.S. am Permanenter Link
In der ökonomischen Gesellschaft/Gemeinschaft eines Landes/der Welt gibt es zwei Aufgaben:
- Güter und Dienstleistungen zu produzieren
- Güter und Dienstleistungen zu verteilen.
Um möglichst viel Güter und Dienstleistungen zur Verfügung zu haben gilt es, alle Beteiligten zum Fleiß anzuspornen und gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Die so geschaffenen Güter und Dienstleistungen sind dann der "Kuchen", der verteilt werden kann. Ohne die Leistung aller gibt's keinen Kuchen, ohne "Schuften für alle" gibt es keinen "Wohlstand für alle". In sofern sehe ich keine Alternative zur Leistungsgesellschaft, außer "weniger Wohlstand für alle".
Wie verrückt man es beim Schuften für den materiellen Wohlstand treibt, ist eine gesamtgesellschaftlich zu verhandelnde Frage. Als Individuum kann man nur "aussteigen".
Die Verteilungsfrage ist gesamtgesellschaftlich zu verhandeln. Die Erfahrung zeigt, dass Umverteilung bei den Leistungserbringern die Leistungsmoral schädigt. Etwas Umverteilung wird aus Einsicht in die Notwendigkeit des Staates und öffentlicher Dienste sowie aus sozialen Gründen akzeptiert. Wird die Umverteilung zu stark, weichen viele Leistungserbringer in Teilzeit, Vorruhestand, Sabbaticals aus.
Wer freiwillig "für die Steuer" schuftet, ist ein Heuchler oder ein Idiot.
Davon unberührt bestehen Möglichkeiten einzelner, ohne eigenen Fleiß am allgemeinen Wohlstand zu partizipieren. Wie man damit umgeht, ist auch eine gesamtgesellschaftlich zu verhandelnde Frage. Ein schönes Beispiel sind sogenannrte Bet-Orden, meist Nonnen, die sich dafür bezahlen lassen, im Auftrag ihrer Klienten für deren Wünsche/Interessen zu beten.
Rudi Knoth am Permanenter Link
Nun sollte man nachfragen, wer denn ein "Leistungsträger" ist.
A.S. am Permanenter Link
Die Frage stellen Sie zu Recht. Aber wer bewertet, wer kann bewerten, wer genau wieviel leistet? Sollen das die Politiker tun? Oder Gerichte?
Wenn denn das nicht das kirchliche Arbeitsrecht im Sozialbereich wäre...
Assia Harwazinski am Permanenter Link
Eindeutig die Pflege(fach)kraft.
A.S. am Permanenter Link
Nachtrag:
Versteckt sich nicht allzu oft hinter dem Ruf nach Solidarität der Egoismus der anderen?
Nachzulesen im autobiografischen Vorspann zu Jordan Peterson: "Warum wir denken wie wir denken"
Tilman Weigel am Permanenter Link
Armin Pfahl-Traughber kritisiert, dass wir keine "echte" Leistungsgesellschaft hätten. Aber das behauptet Michael Sandel auch nie.