Spektakuläre Töne in der jetzt veröffentlichten Begründung des Bundesverwaltungsgerichts zur prinzipiell erlaubten Abgabe von tödlichen Mitteln an Suizidwillige: Freitodhilfe durch Natrium-Pentobarbital als mögliche letzte Therapie – man mag es kaum glauben. Und die Reise zu einer Schweizer Sterbehilfeorganisation stelle "wegen der damit verbundenen Belastungen keine zumutbare Alternative" für die Betroffenen dar. So human klang es selten aus dem Mund Deutscher Richter. Allerdings mussten sie dafür einige juristische Klimmzüge vollbringen. Und die Umsetzung des letztinstanzlichen Urteils steht in den Sternen.
Das vom höchsten Deutschen Verwaltungsgericht in Leipzig nunmehr gemaßregelte Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) ist eigentlich nur zuständig für die Prüfung und Zulassung von Arzneimitteln. 2004, als es den Antrag der suizidwilligen, vollständig gelähmten Frau K. mit hohem Querschnitt zurückwies, hätte jeder Beobachter eine andere Entscheidung - also eine Bewilligung - des BfArM für völlig abwegig und undenkbar gehalten.
Der § 3 Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz macht es möglich
Wieso sollte überhaupt eine Privatperson dort ein Mittel käuflich erwerben können – wie es zum jetzigen Stand schon etwa zwei Dutzend weitere Menschen beantragt haben? Die Einstiegslücke musste überhaupt erst einmal herausgefunden und erkannt werden. Im § 3 Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz heißt es recht lapidar:
(1) Einer Erlaubnis des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte bedarf, wer
1. Betäubungsmittel anbauen, herstellen, mit ihnen Handel treiben, sie, ohne mit ihnen Handel zu treiben, einführen, ausführen, abgeben, veräußern, sonst in den Verkehr bringen, erwerben oder
2. ausgenommene Zubereitungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) herstellen will.
Demnach könnte der Antrag eines Suizidwilligen ungefähr so lauten: "Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich eine Ausnahmeerlaubnis nach § 3 Absatz 1 Betäubungsmittelgesetz, um das für meine Selbsttötung risikolos und am besten geeignete Natrium-Pentobarbital in einer Apotheke erwerben zu dürfen. Ich habe eine metastasierende Krebserkrankung, leide unter Erbrechen und ständigen Schmerzen, die nicht behandelbar sind. Mein Hausarzt kann das bestätigen. Eine vom Bundesverwaltungsgericht vorausgesetzte Ausnahme lieg somit vor."
Leipziger Richter setzen extremen Notfall als Ausnahme voraus
Nun liegt die ausführliche schriftliche Begründung vor. Dort lautet ein Leitsatz, wonach der staatliche Lebensschutz – gemäß des einschlägigen Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte – jedenfalls nicht ausnahmslos und ungeprüft gelten darf:
"Ein ausnahmsloses Verbot, Natrium-Pentobarbital zum Zweck der Selbsttötung zu erwerben, greift in das grundrechtlich geschützte Recht schwer und unheilbar kranker Menschen ein, selbstbestimmt darüber zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt ihr Leben enden soll.
… Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde sichern gemäß Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG jedem Einzelnen einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung, in dem er seine Individualität entwickeln und wahren kann … Dazu gehört, dass der Mensch über sich selbst verfügen und sein Schicksal eigenverantwortlich gestalten kann ..."
Das Bundesinstitut (BfArM) hat nun zu beurteilen, ob der vom Gericht umschriebene Ausnahmefall vom prinzipiell geltenden Verbot vorliegt. Wie bereits bei Urteilsverkündung im März deutlich geworden war, sind die Voraussetzungen an drei wesentliche Kriterien gebunden:
Erstens muss sich dem Urteil zufolge der Antragsteller in einer extremen Notlage befinden - also unter einer schweren, unheilbaren Krankheit leiden, die mit "gravierenden körperlichen Leiden, insbesondere starken Schmerzen verbunden ist". Zweitens muss er zu einer freien, ernsthaften Entscheidung in der Lange sein. Und drittens: Es darf keine andere "zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbewunsches" zur Verfügung stehen, wie etwa das Abschalten von lebenserhaltenden Maschinen - welches aber dann auch zu einem humanen, schnellen Tod führen müsse. Das kann bei Beendung einer künstlichen Beatmung nicht immer garantiert werden, wenn z. B. doch eine Spontanatmung wieder einzusetzen beginnt.
Wie soll die nötige Leidensfähigkeit geprüft werden?
Das Leipziger Gericht schreibt: "Der Senat verkennt nicht, dass dem BfArM schwierige Bewertungen abverlangt werden und seine Entscheidung einen in hohem Maße sensiblen Bereich betrifft". Dies gelte umso mehr, als es wegen der Entscheidung über hochrangige Rechtsgüter einer "besonders sorgfältigen Überprüfung" bedürfe. Beim Abbruch lebenserhaltender Maßnahmen sei das aber nicht anders. Im Zweifel müsse man eben Sachverständige hinzuziehen. Denn: "Die staatliche Gemeinschaft darf hilflose Menschen nicht einfach sich selbst überlassen", so die Richter.
Einer, der die Schwere des Leidens seit Jahren untersucht, ist der Palliativmediziner Dr. Matthias Thöns: "Ich frage meine Patienten: Wie stark leiden Sie unter Atemnot und unter Schmerzen", erläutert er. "Da gibt es eine Skala von 0 bis 10, und der Patient beurteilt das selber. Wenn ein Patient sagt, das ist 10 - unerträglich stark, dann heißt das: unerträglich stark." Gegen Thöns wird argumentiert: Wenn Patienten über die Palliativmedizin und Hospizversorgung körperliche und seelische Schmerzen genommen werden, dann könnte die Skala schnell wieder runter auf 2 oder 3 gehen.
Objektivierbare Kriterien gibt es aber nach übereinstimmender Auffassung nicht oder kaum – auch nicht, was die Zumutbarkeit einer Alternative betrifft. Was eine oft als Gegenargument gegen die Suizidhilfe bemühte dauerhaft tiefe, sog. terminale Sedierung betrifft: Wo würde die wohl verlässlich zur Verfügung stehen? Umso mehr bleiben die subjektiven Kriterien maßgeblich. Das hat offenbar auch das Gericht im Auge, wenn es gegen Ende der Begründung zum beanstandeten Entscheid des Bundesinstituts ausführt: "Die Feststellung, dass das BfArM zur Erlaubniserteilung verpflichtet gewesen wäre, lässt sich ohne die erforderliche Sachverhaltsprüfung und -aufklärung nicht treffen. Das kann nach dem Tod von Frau K. nicht mehr nachgeholt werden. Insbesondere die Frage, ob zumutbare Alternativen zur Verfügung gestanden hätten, ist ohne ihre Beteiligung nicht mehr zu klären." Das beträfe etwas die Frage, ob sie einen palliativmedizinisch begleiteten freiwilligen Verzicht auf Nahrung für sich als zumutbar angesehen hätte.
Juristische Klimmzüge auf dünnem Eis
Doch wäre nicht ein solches regelmäßiges "Alternativangebot" eine Suizidförderung und damit nach § 217 StGB strafbar? Die Leipziger Richter wollen das nicht sehen. Sie glaube auch nicht, dass ihr Urteil dem Sterbehilfegesetz im § 217 StGB zuwiderläuft. Denn sie betonen: Ohne Ausnahmefall keine tödlichen Medikamente. Also könne auch kein "Anschein von Normalität" entstehen. Zudem würde die Behörde selbst gar nicht geschäftsmäßig tätig werden können – was ja allein strafbar ist.
Noch kühner wirkt ein weiterer Klimmzug des Gerichts: dass nämlich der Staat in die Freiheit zum selbstbestimmten Sterben eingreift, indem er den Zugang zu den tödlichen Medikamenten beschränkt. Das Gericht räumt ein: "Es kann dahinstehen, ob darin ein Eingriff im klassischen Sinne zu sehen ist." Und schließlich ein dritter Klimmzug: Die Richter müssen ihr Urteil mit den maßgeblichen Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes in Einklang bringen. Danach dürfen Mittel wie Natrium-Pentobarbital nur zu Therapiezwecken herausgegeben werden. In einer extremen Notlage, so das Gericht, "kann die Anwendung eines Betäubungsmittels zur Selbsttötung ausnahmsweise als therapeutischen Zwecken dienend angesehen werden".
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat keine Eile, sich mit den mittlerweile vorliegenden Anträgen auf eine tödliche Medikamentendosis zu befassen. Einfach genehmigen geht wohl ohne verwaltungsmäßige Ausführungsbestimmung nicht, andererseits sind bei Ablehnung neue Klagen zu erwarten. Denn das Urteil ist rechtskräftig und gewährt Patienten einen juristisch durchsetzbaren Anspruch.







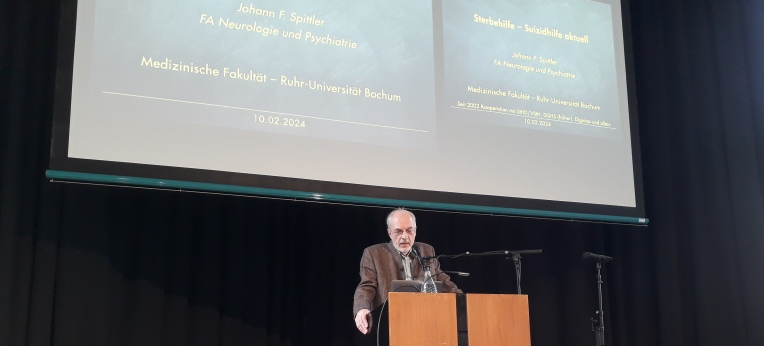
3 Kommentare
Kommentare
Hans Trutnau am Permanenter Link
Eingriff in meine Selbstbestimmung bleibt Eingriff, ob mit oder ohne Klimmzüge. Dagegen verweigere ich mich.
Hans Trutnau am Permanenter Link
findet es gut, dass das Bild ausgetauscht wurde.
Alfons Pfender am Permanenter Link
Was soll im Jahr 2017 dieser Weiterleidenszwang bei unermesslich leidenden chronisch Kranken durch die Verunmöglichung der Sterbehilfe.