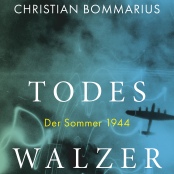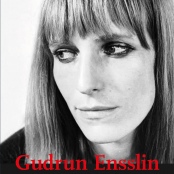Kaum beirrt von Bombenkrieg, Kapitulation und alliierter Besatzung liefen Gerichtsverfahren vor und nach 1945 einfach weiter, mit denselben Akteuren, nach den gleichen Regeln. Benjamin Lahusen beschreibt eindrucksvoll das Weiterfunktionieren des juristischen Gerichtsbetriebs in Deutschland zwischen 1943 und 1948. Ein erhellendes, kluges Buch – das bereits vor zwei Jahren erschienen ist – und trotzdem unbedingt gelesen werden sollte.
Es gehört zu den professionellen Gepflogenheiten der Verlagsbranche, dass neue Bücher beim Erscheinen mit Reklame rechnen dürfen, also mit Anzeigen, Buchhandels-Aktionen oder einem Auftritt bei Lanz. Es sind nicht immer die wichtigsten Bücher, die hier beworben werden. Vor allem öffentliche, verkaufsversprechende Titel, samt prominenter Autorenschaft werden mit Wucht und Elan "gepusht". Verlagsprofis nennen so etwas "Book-Marketing". Und dann gibt es Bücher – es sind nur wenige, ausgesuchte – die in den sogenannten "Leitmedien", also in der FAZ, der NZZ, der Süddeutschen, im Spiegel oder der ZEIT vorgestellt und besprochen werden. Kurzum: vielen – wenn nicht den meisten Neuerscheinungen – ist das Schicksal beschieden, konsequent übersehen und ignoriert zu werden. Sachbücher haben es besonders schwer. Trotz erhellender Welt- und Wirklichkeitserklärung gelten sie beim Lese-Publikum aus tröge, langatmig und mitunter schwer verständlich. Ein Vorurteil, dass sich hartnäckig hält, seit es Bücher gibt. Grund genug also, für spannende, kenntnis- und erkenntnisreiche, gut und verständlich geschriebene Bücher "Reklame" zu machen.
Von einem besonders aufklärenden und klugen Buch soll hier die Rede sein. Es ist bereits vor zwei Jahren erschienen, seither vielfach und einhellig lobend rezensiert – vor allem als Lese-Stoff für die juristisch akademische Zielgruppe gedacht. Titel: "Der Dienstbetrieb ist nicht gestört". Der Rechtshistoriker Benjamin Lahusen hat es geschrieben, ein intellektueller Freigeist, der als Professor Bürgerliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte an der Viadrina in Frankfurt/Oder lehrt. Es geht darin um die geradezu unheimlichen Kontinuitäten der deutschen Justiz zwischen 1943 und 1948, als das "Tausendjährige Reich" in Schutt und Asche versank und bereits in Trümmern lag und Partei, Staat und Volksgemeinschaft dennoch alles taten, im großen Niedergang auf dem kleinen "Normalen" zu beharren. Und so liefen - kaum beirrt von Bombenkrieg, Kapitulation und alliierter Besatzung - Gerichtsverfahren vor und nach 1945 einfach weiter, mit denselben Akteuren, nach den gleichen Regeln. Ob Nachbarschaftsstreits um die Kehrwoche, kleiner Diebstahl, oder unerlaubter Herrenbesuch – der juristische Alltags-Dienstbetrieb musste aufrechterhalten werden, ein Stillstand der Rechtspflege unter allen Umständen vermieden werden. Es galt, ein Justitium, so der Fachbegriff für den erzwungenen "Stillstand der Rechtspflege", unbedingt zu vermeiden. Und so verrichteten die NS-Juristen ihre Arbeit im Schatten der Gewalt als wäre nichts passiert. Beispielsweise in Stuttgart, im September 1944: Das Justizgebäude wird dort durch neun Sprengbomben und zahlreiche Brandbomben weitgehend zerstört, doch stolz meldet der Generalstaatsanwalt, dass bereits am nächsten Morgen "noch in den Rauchschwaden... eine Reihe von Strafverhandlungen durchgeführt" wurden. Auch andernorts wird der Dienstbetrieb in teils noch brennenden Gebäuden aufrechterhalten, selbst unter Artilleriebeschuss. Gesetz ist Gesetz. Befehl ist Befehl.
Eine "Stunde Null" aber hat es in der deutschen Justiz nach 1945 nie gegeben.
Benjamin Lahusen hat sich die Akten zahlreicher Gerichte aus den Jahren vor und nach 1945 angesehen und beschreibt collageartig, wie weder "Endkampf" noch staatlicher Zusammenbruch den juristischen Dienstbetrieb unterbrechen konnten. Trotz "totalem Krieg" blieb im Grunde alles beim Alten. Auf das juristische Personal war weiterhin Verlass: Pflichterfüllung, Gehorsam und volle Einsatzbereitschaft garantierten einen – oft improvisierten – dennoch halbwegs geordneten Dienstbetrieb. Bis zum düsteren Ende.
Mai 1945: Schuld. Schutt und Scham: Wer war Täter, wer nur Mitläufer? Ein Volk, das sich als Verlierer fühlte, aber nicht unbedingt als schuldig. Auch die Juristen wollten die große Selbst-Reinigung, die "Ent-Nazifizierung", am liebsten in Eigenregie. Gab es nicht "anständige" und "unanständige" Nazi-Juristen? Lahusens Buch zeigt klar, dass von einem Justitium oder einer "Stunde Null" in Bezug auf die deutsche Justiz nicht die Rede sein kann. In der Justizgeschichte wird das Schema des Vorher-Nachher allzu gerne bemüht. Auf der einen Seite die Auswüchse der NS-Justiz – Volksgerichtshof, Sondergerichte, Militärgerichte, Standgerichte – auf der anderen Seite die aufrechten, unbelasteten Juristen, die nun in der deutschen Ruinenlandschaft für den Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz sorgten. Es ist eine der Legenden der Nachkriegszeit, eine Lebenslüge, die in der Nachkriegszeit gerne bemüht wurde und noch heute konserviert wird. Eine "Stunde Null" aber hat es in der deutschen Justiz nach 1945 nie gegeben.
Richter und Staatsanwälte, die bis 1945 im Justizdienst gestanden hatten, kehrten in die Justiz zurück. Man störte sich offenbar nicht daran, dass selbst schwerbelastete ehemalige Volksgerichtshofrichter jetzt wieder Recht sprachen, häufig in herausragenden Positionen: Beispielsweise Dr. Paul Reimers, Richter am Volksgerichtshof, Mitwirkung an 124 Todesurteilen, und Otto Rahmeyer, Ankläger am Volksgerichtshof, Mitwirkung an mindestens 78 Todesurteilen. Die beiden Hinrichter brachten es bis zum Landgerichtsrat in Ravensburg, wo sie sich bis 1963 erneut für die Rechtskultur verdient machen durften.
Nach 1945 mussten die NS-Todesrichter nichts befürchten. Im Gegenteil: Beinahe in allen Verfahren gegen die Nazi-Justiz durften die Angeklagten mit besonderem Feingefühl und Verständnis ihrer Zunftkollegen rechnen. Kaum ein Urteil war der Nachkriegsjustiz oberflächlich und barbarisch genug, als das es nicht doch Gründe dafür gab, dass "damals anzuwendende Recht" zu legitimieren. Die verhinderten Ermittlungen, das großzügige Verständnis, die laxen Urteile, die zahllosen Freisprüche – das alles war charakteristisch für die Nachkriegsjustiz, wenn es um die Tätigkeit der NS-Juristen ging. Die Formel des "mangelnden Unrechtsbewusstseins" wurde für die ehemaligen nationalsozialistischen "Rechtswahrer" zum Blankoschein. Auf die Solidarität ihrer Richterkollegen konnten sie ohnehin zählen, ein ausgeprägter Korpsgeist garantierte dafür. Und deren Friedfertigkeit fand durchaus die Zustimmung der meisten Deutschen. Die Justiz gab sich insofern durchaus volksnah. Das Ausbleiben der strafrechtlichen Sühne für richterliche Verbrechen war nur Teil des großen kollektiven Verdrängungsvorgangs. Die Zeit der Integration der Justiz-Täter.
Lahusen dokumentiert in seinem Buch einen exemplarischen, ganz "normalen" Karriere-Weg eines NS-Richters. Hans Keutgen (1912–1999), der gegen Kriegsende als letzter Richter des Sondergerichts Aachen amtierte – und nun nahtlos seine Karriere fortsetzte. Wie viele andere belastete Juristen wurde er schon kurz nach dem Kriegsende reaktiviert. Obwohl nachweislich an Todesurteilen beteiligt, ließ die britische Militärregierung ihn bereits im August 1945 erneut als Richter zu. Eine 1965 erhobene Strafanzeige eines NS-Verfolgten wurde vom Oberlandesgericht Köln ohne weitere Ermittlungen eingestellt. Und als ob dies nicht schon genug gewesen wäre, erhielt der frühere NS-Richter kurz nach Kriegsende für eine zeitweilige Versetzung nach Bautzen und Umgebung eine "Trennungsentschädigung" von knapp 1.000 Reichsmark ausgezahlt. In den 1970er-Jahren folgte dann eine entsprechend angepasstes Pension – die auch der Mehrzahl aller ehemaligen NS-Richtern ausgezahlt wurde. Keutgen war kein Einzelfall. Er war die Regel. Die "Stunde Null" – auch das beschreibt und belegt Lahusen umfassend – jedenfalls eine Legende. Ganz nach dem Rechtfertigungs-Motto von Hans Filbinger, "Was damals Recht wahr, kann heute nicht Unrecht sein", ein Mann, der als Militärrichter in den letzten Kriegstagen an Todesurteilen beteiligt war und es dennoch als späterer CDU-Politiker zum Ministerpräsidenten eines Bundeslandes bringen konnte.
Am Ende seines Buches bilanziert Lahusen nüchtern: "Die Banalität des juristischen Dienstbetriebs vollzog sich inmitten der deutschen Kollektivraserei, neben Konzentrationslagern, Todesmärschen, auch neben Bombenkrieg, Volksturm, Besatzung, Flucht … ". Und er fragt: "Ist das nun der Gipfel der Zivilisation oder ihre letzte Perversion?" Nach der Lektüre ist man geneigt zu antworten: Beides! Zu wünschen bleibt in jedem Fall, dass Lahusens eindringliches, erhellendes und spannend geschriebenes Buch eine erweiterte Leserschaft findet. Ein günstige Taschenbuchausgabe ist überfällig.
Benjamin Lahusen, Der Dienstbetrieb ist nicht gestört. Die Deutschen und ihre Justiz 1943-1948, 380 Seiten, C.H. Beck, 34,00 Euro