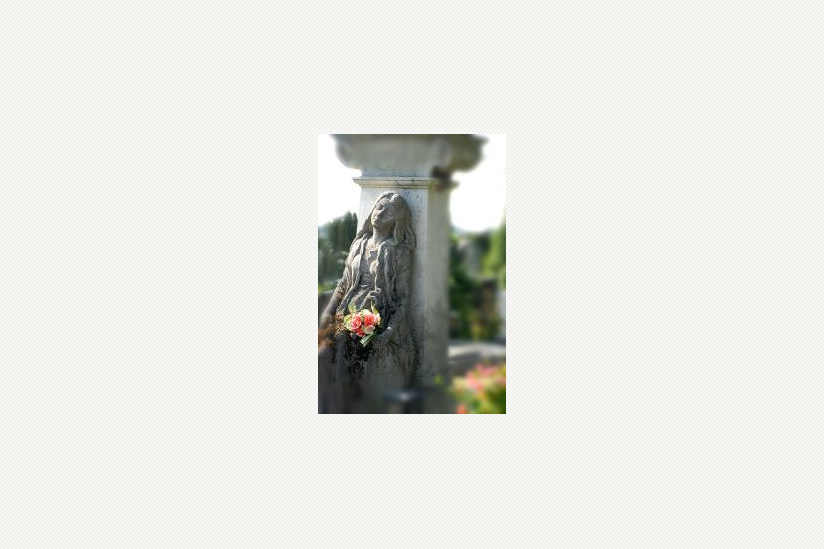WIEN. (fdbö/hpd) Wenn Menschen sterben, kommt fast immer die Religion ins Spiel. Bei Angehörigen in der Trauerbegleitung, für sie und für Freunde und Bekannte beim Begräbnis. Zweifellos helfen Rituale, die Trauer zu verarbeiten. Aber müssen sie religiös sein? Christoph Baumgarten geht dieser Frage in einem sehr persönlichen Text nach.
Liebe M., fühle ich mich versucht, diesen Text zu beginnen. Ihn als Brief zu schreiben an eine Tote. Ein Abschiedsbrief, wie so viele an sie geschrieben wurden. Vorderhand ein Text, der sich an ein Häuflein Asche in einer Urne richtet. Im eigentlichen Sinn ein Brief an sich selbst und an Überlebende. Freunde, Angehörige Ms. Trauerarbeit ist immer egoistisch. Je näher einem der Mensch gestanden ist, desto mehr. Je größer der Schmerz, desto mehr geht es darum, ihm Ausdruck zu verleihen. Die eigene Befindlichkeit ist stärker als die Empathie. Und gleichzeitig muss er öffentlich ausgelebt werden. Nur wenige Menschen sind imstande, den Tod eines oder einer Nahestehenden zu verarbeiten, ohne den eigenen Gefühlen vor anderen Ausdruck zu verleihen und ohne andere zu beobachten, wie sie das gleiche tun. Ein egoistisches Erlebnis, das nur in Gemeinschaft möglich ist. Paradox.
Wie die meisten Menschen hasse ich Begräbnisse. Als Kind war ich des öfteren zugegen, wenn Menschen beerdigt wurden, die ich nicht einmal kannte. Dass mich Wildfremde umarmten und mir Beileid wünschten, hat das nicht verhindert. Zum Begräbnis meines Großvaters ging ich nur, weil das von mir erwartet wurde. Ich hatte nie eine enge Beziehung zu ihm. Dort zu sein, Abschied zu nehmen, war mir kein inneres Bedürfnis. Innerlich verabschiedet hatte ich mich lange davor. Es war ein laizistisches Begräbnis. Mein Großvater war vor Jahrzehnten aus der Kirche ausgetreten. Abgegangen ist mir ein Pfarrer, wie ich von früheren Begräbnissen kannte, nicht. Auch meinem zweiten Großvater, erzkatholisch, hat der nicht gefehlt.
Ms. Begräbnis war das erste, zu dem ich aus innerem Antrieb gegangen bin. Sie war mir eine gute Freundin. Ihr Tod war überraschend. Selbstmord. Alkohol und Tabletten, nach jahrelangen Depressionen und mehreren Suizidversuchen. Seitdem ich von ihrem Tod erfahren hatte, hatte ich nur mehr ein Bild von ihr im Kopf. Wie zwei Sanitäter sie aus dem Tor ihres Wohnhauses heraustrugen, nach ihrem letzten Selbstmordversuch. Ihr Gesicht grau, faltig, die Augen abwesend. Weggetreten von dem Alkohol und den Medikamenten. Ich hatte damals mit einer gemeinsamen Freundin den Rettungseinsatz koordiniert.
Ein abstoßendes Bild. Nicht das, woran man sich erinnern will, wenn man an eine gute Freundin denkt. Zwei Wochen lang kämpfte ich um ein anderes Bild. Ich wusste, es musste in meinem Kopf sein. Ich konnte mich an die schönen Zeiten erinnern. Ich konnte mich erinnern, dass M. gern gelacht hat, dass sie ein unglaublich herzlicher, mitfühlender Mensch war. Nur sehen konnte ich sie nicht, auch nicht lachen hören. Das einzige Bild, das ich hatte, war dieses graue Wesen, das Sanitäter in den Notarztwagen trugen.