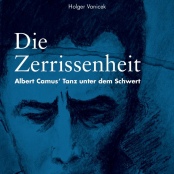BERLIN. (hpd) Was passiert, wenn Geschwister ungleicher nicht sein können, nämlich ein Menschenkind und ein im Haushalt eines Forschers aufgezogenes Schimpansenkind? Wenn sie sich doch für Gleiche halten? Dieser Frage geht Karen Joy Fowel in ihrem Roman "Die fabelhaften Schwestern der Familie Cooke" nach. Eine Geschichte voller Verluste und Traumata einer zerbrochenen Familie, die trotzdem auf die unterhaltsamste Art rüberkommen.
Rosemary lässt sich treiben. Sie studiert ziellos dahin, hat kaum Freunde und flüchtige Beziehungen unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Sie versucht, sich zu erinnern. Wenn sie auch in flapsigem Tonfall mit sich selbst viel zu ausgiebig über sich selbst redet, so spricht sie doch im Grunde genommen die ganze Zeit über ihre abhanden gekommenen Geschwister. Auch dann, wenn sie nicht über sie spricht. Die eine ist Fern, eine Schimpansin. Denn die beiden wurden die ersten fünf Jahre ihres Lebens gemeinsam aufgezogen, von denen die erwachsene Rose aber kaum noch etwas weiß. Der andere, der ältere Bruder, verließ ein paar Jahre darauf das Elternhaus und wurde Mitglied der Animal Liberation Front und lebt seither auf der Flucht vor der Staatsmacht, wie alle viel später erfahren.
Was geschieht eigentlich mit einem Menschenkind, wenn es gemeinsam mit einer Äffin heranreift, um der Wissenschaft willen? Rose benimmt sich nicht tierisch, aber ein bisschen impulsiver, ein bisschen empathischer ist sie doch. Ein bisschen öfter hat sie das Bedürfnis, zu gestikulieren oder andere zu berühren. Das reicht, um im Kindergarten schon anders zu sein und an der Uni eine Looserin.
Nicht umsonst ist Rose aber auch die Tochter eines Psychologen. Sie erkennt, dass jenes fünfjährige Experiment, deren Probandin sie auch war, eigentlich hätte heißen müssen: Wieweit ist eine Verständigung über die Artgrenze möglich? Nicht nur, wie lernte die Äffin Sprache, sondern auch sie, Rose, die Sprache ihrer Schwester Fern. Der Versuch lief unter der Prämisse, dass auch Menschen Tiere sind, und hatte dennoch das dabei irritierende Ziel, ständig festzuhalten, was den Menschen auszeichnet.
Schon das Kleinkind Rose hatte das schnell heraus. Sie redete pausenlos. Wollte schon von ihrer Babysitterin immer neue imponierende Worte hören, die kaum keiner kannte. Und schrieb Jahre später ihre Geschichte auf. Die ist aber auch eine Suche nach der Geschichte hinter der Geschichte. Denn an ein Primatenforschungszentrum abgegeben, verurteilt fortan zu einem Leben hinter Gittern, hatte der Vater Fern, nachdem das Menschenkind die Eltern vor die Alternative gestellt hatte: Sie oder ich!
Eifersucht war auch im Spiel. Rose wurde schnell klar, dass sie nur deshalb in jeder ihrer Äußerungen soviel Beachtung fand, weil sie im Vergleich zu denen von Fern beobachtet und festgehalten wurden.
Aber da war auch die Angst. Fern hatte ein Katzenbaby, das das Kind ihr in die Hand gegeben hatte, getötet. Und zwar neugierig und völlig gefühllos.
Den Roman der amerikanischen Autorin (der ganz am Ende doch noch gut ausgeht, jedenfalls für Rose) kann man auch als Parabel lesen. Wenn der Mensch sich dem Affen als Gleicher fühlt, wenn er sich erst durch Leistung als einzigartig auszeichnen muss, wenn man ihm dabei dieselbe Grundausstattung an körperlichen Bedürfnissen zugesteht, was macht das dann mit ihm? Einfach wird es jedenfalls nicht.
Karen Joy Fowler: "Die fabelhaften Schwestern der Familie Cooke", Manhattan Verlag München 2015, 352 S., 17,99 Euro