BASEL. (hpd) Peter Singers jüngste Aussagen sowie Michael Schmidt-Salomons Replik haben hohe mediale Wellen geworfen und für kontroverse Diskussionen gesorgt. Die folgende Stellungnahme gibt den Standpunkt der GBS Schweiz wieder, die sich mit der Philosophie des effektiven Altruismus (EA) identifiziert.
Peter Singer hat den EA nicht selbst entworfen, sondern bewirbt ihn vor allem öffentlich. Unter effektiven AltruistInnen sind manche seiner Aussagen stark umstritten. Einig sind sich die allermeisten EAs darin, dass viele der Themen, die aktuell kontrovers diskutiert werden, für den EA irrelevant sind. Auch einige von Schmidt-Salomon in diesem Kontext geäußerte Bemerkungen werden von EAs kritisiert – obgleich zu betonen ist, dass sich Schmidt-Salomon mit der GBS Deutschland schon länger für die Grundideen des EA stark macht.
Folterverbot, Utilitarismus und Deontologie
Sollte man in einer hypothetischen Situation ein Kind foltern, wenn man damit die Folter unzähliger Kinder verhindern kann? Dazu meint Singer: Ja. Denn jedes Kind hat dasselbe Recht, von Schäden frei zu bleiben. Die Folter der unzähligen Kinder zuzulassen käme dem folgenden Urteil gleich: Das eine Kind hat ein gewichtigeres Recht, von Folter frei zu bleiben, als die unzähligen Kinder zusammen. Ein solches Urteil wäre ethisch nicht zu rechtfertigen (vgl. dazu unseren Artikel “Wie wir moralische Entscheidungen fällen”) und wäre insbesondere mit dem Prinzip der gleichen Berücksichtigung gleicher Interessen unvereinbar. In dieser theoretischen Hinsicht scheint der Utilitarismus vernünftig zu urteilen. Aber: Es gibt eine gesellschaftlich-praktische Hinsicht, in der die Deontologie – der (angebliche) philosophische Gegenspieler des Utilitarismus – vernünftig urteilt: Rechtlich ist es wichtig, ein striktes Folterverbot zu statuieren. Denn würde man Folter zulassen, würde dies mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sie zu Zwecken verwendet wird, die nicht der Leidminderung dienen. Zudem senden grausame Staatspraktiken gefährliche Signale aus, die auch utilitaristischen Zielen längerfristig zuwiderlaufen. Utilitarismus und Deontologie sind, so verstanden, miteinander vereinbar und ergänzen sich gut (vgl. dazu auch das Konzept des Two-Level-Utilitarismus).
Zudem: Eine wichtige Erkenntnis der zeitgenössischen Ethik besteht in diesem Zusammenhang darin, dass es gar nicht notwendig ist, zwischen verschiedenen Werten bzw. Prinzipien strikt zu wählen: Wenn etwa bei konkurrierenden naturwissenschaftlichen Theorien Unsicherheiten bestehen, wäre es irrational, mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% an die eine oder andere zu glauben. Eine breitere Wahrscheinlichkeitsverteilung – etwa 50-30-20%, bei drei konkurrierenden Theorien – ist dann angemessen. Analoges gilt für die Wahrscheinlichkeitsverteilung und die Gewichtung bei konkurrierenden Ethiken: Man kann unterschiedlichen Theorien – etwa dem Utilitarismus und der Deontologie – Plausibilität zusprechen und sie in der Praxis entsprechend (gewichtet) berücksichtigen.
Schmidt-Salomon unterstellt Singer, uns mit “ein Kind vs. unzählige Kinder” vor eine falsche Alternative zu stellen. Diese Kritik ist merkwürdig, denn es handelt sich um ein Gedankenexperiment. Gedankenexperimente haben nicht zum Ziel, die Realität abzubilden. Es geht ihnen darum, ethisch interessante Variablen zu isolieren. Sie sind ein Werkzeug, herauszufinden, worin unsere Handlungsziele letztlich bestehen (vgl. dazu den Artikel “Gedankenexperimente in der Ethik”): Geht es letztlich darum, möglichst viel Leid zu verhindern – oder eher darum, aktive Leidverursachung zu verhindern? Das eingangs erwähnte Gedankenexperiment scheint nahezulegen, dass es um Ersteres geht.
Zu Recht gibt Schmidt-Salomon allerdings zu bedenken, dass es gefährlich ist, entsprechende Gedankenexperimente in praktisch-politischen Kontexten überhaupt vorzubringen – insbesondere wenn nicht betont wird, dass die darin enthaltenen Annahmen bloß im Rahmen des hypothetischen Gedankenexperiments gelten. Im praktisch-politischen Kontext erfüllen Gedankenexperimente nicht den erhofften Zweck und laden zu Missverständnissen ein. Hier konkret z.B. zum Missverständnis, das rechtliche Folterverbot werde von Singer infrage gestellt – was nicht der Fall ist.
Viele EAs versuchen, ihr Handeln auf die utilitaristische Leidminimierung auszurichten und dabei keine deontologischen Handlungsregeln zu verletzen. Das ist ein vernünftiges Win-Win. Der EA kann insofern als Synthese von Utilitarismus und Deontologie verstanden werden: Einerseits verfügen sowohl das utilitaristische Ziel als auch (viele) deontologische Handlungsregeln grundsätzlich über Plausbilität, und andererseits kann argumentiert werden, dass deontologische Regeln in der Praxis oft auch aus dem Utilitarismus selbst folgen.
“Lebensrecht für alle, Lebenspflicht für niemanden!”
Schmidt-Salomon schreibt in seiner Replik:
“Selbstverständlich sollte jeder Mensch, ob behindert oder nicht, ab der Geburt ein unverbrüchliches Recht zu leben besitzen, aber er sollte nicht gezwungen sein, weiterleben zu müssen, wenn dies nicht in seinem eigenen Interesse ist. Dies ist eine klare, unmissverständliche Position, für die man auch in der Bevölkerung großen Rückhalt finden kann! Deshalb ist es mir völlig unverständlich, warum Peter Singer das Recht auf Leben ab der Geburt so scharf angreift!”
Das Problem dabei: Es ist nicht in allen Fällen klar, dass das Weiterleben eines Säuglings tatsächlich in dessen Interesse ist. Der deontologisch orientierte Zürcher Ethik-Professor Peter Schaber äusserte sich in einem Zeitungsinterview zur Frage “Aber ist es denn nicht vertretbar, einen kleinen behinderten Menschen von großen Schmerzen zu befreien?” wie folgt:
“Es macht dann Sinn, auf gewisse lebenserhaltende Operationen zu verzichten, wenn die Eltern das wünschen. Mit dieser passiven Sterbehilfe darf ein Kind sterben, wenn sein Leben nur Leiden bedeutet.”
In der Tat ist dies in unseren Spitälern gängige Praxis. Aus einem Artikel in der Zeit:
“Auch die deutsche Palliativmedizinerin Thela Wernstedt sieht das holländische Protokoll [das bei Säuglingen auch die aktive Sterbehilfe1 erlaubt] skeptisch: ‘Ich fände es ungut für unser Land, wenn wir eine ähnliche Regelung wie in Holland anstrebten.’ Die Ärztin von der Medizinischen Hochschule in Hannover wird gerufen, wenn es keine Hoffnung mehr auf Heilung gibt und es darum geht, Schmerzen zu lindern und das Sterben zu erleichtern."
Weiter zum niederländischen Protokoll:
"Die Idee für das Sterbehilfe-Protokoll reifte in Eduard Verhagen einige Jahre, nachdem er sich aus Angst vor dem Gesetz nicht getraut hatte, der elterlichen Bitte nach Lebensbeendigung eines schwer kranken Babys nachzukommen. Das Kind war mit einer extremen Form der Epidermolysis bullosa geboren worden, einer Fehlbildung der Haut. Bei jeder Berührung löste sich die Haut ab – bis am ganzen Körper nur noch rohes Fleisch zu sehen war. Bei den Verbandswechseln bekam das Baby Morphin, um die entsetzlichen Schmerzen zu lindern. Durch den Vernarbungsprozess verkümmerten die Gelenke, und der Säugling konnte sich bald kaum noch rühren. Fast alle Patienten entwickeln später einen bösartigen Hautkrebs. Das blieb dem Kind erspart. Es starb im Alter von sechs Monaten, zu Hause, an einer Lungenentzündung."
Es gibt Fälle, in denen das Weiterleben unbestritten nicht im Interesse des Säuglings ist. In Fällen schlimmsten Leids scheint es ethisch geboten, von einer Lebens- bzw. Leidensverlängerung abzusehen – das würden wir uns auch für uns selbst wünschen, wenn wir in der Position des entsprechenden Individuums wären. Eine solche Praxis ist mit dem Lebensrecht kompatibel, denn das Lebensrecht impliziert keine Pflicht, am Leben zu bleiben, wenn das Weiterleben nicht mehr im Interesse des betroffenen Individuums ist. Die GBS Deutschland setzt sich mit ihrer Sterbehilfe-Kampagne in der Tat auch für dieses Prinzip ein: “Lebensrecht für alle, Lebenspflicht für niemanden!” Dieses Prinzip speist sich aus altruistischem Mitgefühl und sollte für alle empfindungsfähigen Wesen gelten – auch für Säuglinge.
Was die Frage nach Behinderung und Krankheit bei Föten angeht, moniert Schmidt-Salomon zu Recht, dass Singer viel zu geneigt scheint, etwa beim Down-Syndrom niedrige Lebensqualität anzunehmen. Empirische Studien zeigen in eine andere Richtung. Singer verkennt, dass die Behindertenverbände auch insofern Recht haben, als etwa die (gesellschaftlich übliche) Spätabtreibung von Föten mit Down-Syndrom in altruistischer Perspektive durchaus Probleme aufgibt: Die entsprechenden Abtreibungen scheinen hauptsächlich egoistisch motiviert – man will sich kein behindertes Kind aufbürden. Dieser Wunsch ist verständlich, aber nicht unproblematisch. Denn aus EA-Sicht ist es zentral, gesellschaftlich auf eine bedeutend stärkere altruistische Orientierung hinzuwirken. Eine altruistische Behindertenpolitik muss lauten: Mehr Engagement und Ressourcen für die schwächsten und verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft! Es ist skandalös, dass es politisch beispielsweise kaum gelingt, Großunternehmen zu verpflichten, Arbeitsplätze für Behinderte zu schaffen.
Für den EA ist die ethische Orientierung an der Empfindungsfähigkeit, d.h. an Glück und Leid zentral. Daraus ergeben sich auch wichtige Folgerungen für die Debatte um den moralischen Status von Föten oder Neugeborenen: Schmidt-Salomon stellt fest, dass die populäre Parole “Mein Bauch gehört mir!” philosophisch völlig unreflektiert ist. Ohne Begründung setzt sie voraus, dass es sich beim Embryo bzw. Fötus um ein Wesen handelt, das über keinerlei Rechte verfügt. Diejenigen Singer-KritikerInnen, die “Mein Bauch gehört mir!” schreien, würden gut daran tun, sich systematisch mit Fragen auseinanderzusetzen wie: Was genau unterscheidet ein in der 25. Woche frühgeborenes Baby von einem gleichaltrigen Fötus im Mutterleib, der allenfalls Opfer einer Spätabtreibung wird?
Singer hat, wie Schmidt-Salomon richtig erwähnt, den Präferenz-Utilitarsimus in seinem neuesten akademischen Buch “The Point of View of the Universe” zugunsten des hedonistischen Utilitarismus aufgegeben (vgl. den dritten Abschnitt unten). Der Präferenz-Utilitarismus behauptet, dass eine Schädigung dann vorliegt, wenn Präferenzen verletzt werden. Der hedonistische Utilitarismus dagegen besagt, dass Individuen dann geschädigt werden, wenn ihnen Leid zugefügt oder Glück vorenthalten wird. Die Implikationen dieses Ansatzes scheint Singer allerdings noch nicht vollständig durchdacht zu haben: Die Tötungsfrage kommt nun nämlich ohne die Debatte darüber aus, ob und inwieweit Lebewesen über zukunftsbezogene Präferenzen verfügen. Es genügt die Tatsache, dass es empfindungsfähige Wesen sind, die Glück und Leid empfinden können. Tötet man sie, nimmt man ihnen alle Glückserfahrungen, die sie noch hätten haben können.
Selbstverständlich sind alle Menschen nach der Geburt empfindungsfähige Wesen und haben daher ein Recht auf Leben. Doch die Empfindungsfähigkeit setzt nicht erst bei der Geburt ein: Die Neuronalentwicklung des Fötus legt nahe, dass sie bereits ab der 24. Schwangerschaftswoche vorhanden sein könnte. Daraus resultiert ein Argument für die These, dass Spätabtreibungen ethisch bedeutend problematischer sind, als Singer und Schmidt-Salomon aktuell annehmen. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die Tötung nicht-menschlicher Tiere: Auch sie sind empfindungsfähige Individuen, die (außer im Fall gerechtfertigter Sterbehilfe) etwas zu verlieren haben, nämlich künftige Glückserfahrungen.
Kurzum: Die starke Berücksichtigung auch des hedonistischen Ansatzes – im Gegensatz zum (ausschließlichen) Präferenzansatz – macht altruistisch Sinn, entspricht dem GBS-Slogan “Heidenspaß statt Höllenqual (für alle im Diesseits)” und liefert gewichtige Argumente für eine Ausdehnung des Lebensrechts. Zusätzlich zu allen geborenen Menschen sollte es folgerichtig auch Föten in der späten Schwangerschaftsphase sowie nicht-menschlichen Tieren zugesprochen werden.
Individuum versus “Kollektiv”
Schmidt-Salomon schreibt:
„Hinter der Radikalität, die in dem NZZ-Interview zum Ausdruck kommt, [steckt vermutlich eine] Abkehr Singers von den präferenz-utilitaristischen Positionen“, die er einst vertreten hat: „Im Mittelpunkt des Singerschen Ansatzes standen früher die ‚Interessen der Individuen‘ – nicht der ‚Nutzen der Gesellschaft‘. Ich habe den Eindruck, dass sich dies in den letzten Jahren geändert hat. Singers Argumentation zielt zunehmend auf den größtmöglichen Nutzen innerhalb eines abstrakten Gesamtsystems ab. Die Individuen erscheinen in seinem Denksystem nicht mehr als einzigartige Lebewesen mit ureigenen Interessen, sondern als anonyme Container für quantifizierbare Wohl- oder Unwohlempfindungen, die gegeneinander verrechnet werden. So sehr ich es nachvollziehen kann, dass Peter Singer angesichts der erdrückenden Ungerechtigkeit und Armut in weiten Teilen der Welt eine Überwindung des Egoismus einfordert, halte ich es sowohl ethisch als auch politisch für höchst problematisch, wenn die Anforderungen des Kollektivs so sehr über die Interessen des Individuums gestellt werden.“
Diese Argumentation ist philosophisch unverständlich. Alle Varianten des Utilitarismus sind gleichermaßen “kollektivistisch” bzw. “individualistisch”. Auch dem Präferenz-Utilitarismus geht es um den Nutzen der Gesellschaft – definiert als Erfüllung der Präferenzen möglichst vieler, im Idealfall aller Individuen. Zwischen den “Interessen der Individuen” und dem “Nutzen der Gesellschaft” besteht kein Unterschied. Wollte man den Präferenz-Utilitarismus tendenziös beschreiben, könnte man auch formulieren: Die Individuen erscheinen in seinem Licht als “anonyme Container” für erfüllte und unerfüllte Präferenzen, die gegeneinander verrechnet werden. Im Übrigen: Empirisch-faktisch sind wir biologische Gehirne – und biologische Gehirne wiederum sind Container für Präferenzen sowie Glücks- und Leidempfindungen. Was sollte daran problematisch sein? Und die “Verrechnung” folgt logisch aus der gleichen Berücksichtigung gleicher Interessen.


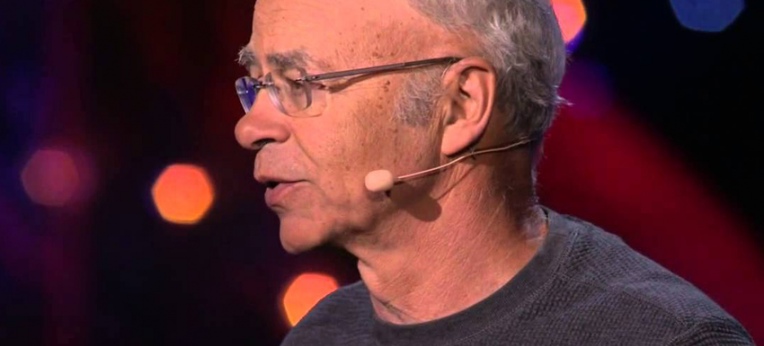


4 Kommentare
Kommentare
David am Permanenter Link
Vielen Dank für die gelungene Auslotung der "Singer vs MSS" Debatte.
cmsadmin am Permanenter Link
"Zwischen den 'Interessen der Individuen' und dem 'Nutzen der Gesellschaft' besteht kein Unterschied."
Gerade die Diktaturen des 20. Jahrhunderts haben gezeigt, das die Interessen der „Klasse“ oder der „Volksgemeinschaft“ nicht deckungsgleich mit den Interessen der Individuen sind.
"Im Übrigen: Empirisch-faktisch sind wir biologische Gehirne – und biologische Gehirne wiederum sind Container für Präferenzen sowie Glücks- und Leidempfindungen. Was sollte daran problematisch sein? Und die 'Verrechnung' folgt logisch aus der gleichen Berücksichtigung gleicher Interessen."
Eine Ethik, die Menschen auf solche abstrakten Konstrukte reduziert, die uns mit Kosten und Nutzen bewerten will, ist totalitaristisch.
"Aus altruistischer Sicht rational und nobel wäre es allenfalls, am Lebensende auf die Ressourcen zur Erhaltung des eigenen Lebens zu verzichten und zu verfügen, dass diese an die effektivsten Hilfsorganisationen zu spenden seien.“
Das erinnert mich an den Ausspruch des ehemaligen Ärztekammerpräsidenten Karsten Vilmar: „wir müssen insgesamt überlegen, ob diese Zählebigkeit anhalten kann, oder ob wir das sozialverträgliche Frühableben fördern müssen.“
"In reichen Ländern kostet die Rettung eines Lebens in der Regel mindestens das Hundertfache."
Auch das Wohnen in Deutschland ist weitaus teurer. Und Medikamente sind (künstlich) teurer. Der direkte Kostenvergleich ist eine Milchmädchenrechnung.
"Wenn jedes Menschenleben – unabhängig vom Geburtsort – gleich zählt, ist es geboten, dort prioritär zu helfen, wo bei gegebenen Hilfsressourcen die meisten Leben gerettet werden können, d.h. in den ärmsten Ländern."
Eltern werden das Leben ihrer Kinder in i.d.R. immer als höherwertiger Betrachten als das Leben anderer. Und was für Eltern gilt, gilt auch für den Lebenspartner oder andere Bezugssysteme.
"Gleichzeitig ist es aber ethisch legitim und wichtig, mit Singer die provokative Frage aufzuwerfen, ob es denn an sich gerechtfertigt ist, das Leid im eigenen Land monetär zur priorisieren.“
Unter der Prämisse könnten wir den Sozialstaat in Deutschland komplett abschaffen.
"Der eine Topf, den die Gesellschaft zum aktuellen Zeitpunkt für altruistische Zwecke aufzuwenden bereit ist, ist beschränkt."
Altruismus ist individuell (und damit subjektiv) und nicht kollektiv. Genau wie verordnete "Solidarität" keine echte Solidarität ist, sondern Zwang ist. Das Ausmaß der Bereitschaft zum Altruismus ist maßgeblich auch von der Empathie zum Hilfsbedürftigen abhängig. Eine verordnete Gleichbehandlung wird die Bereitschaft zum Altruismus sicher nicht fördern. Offenbar ist es der Phantomschmerz der nicht mehr (so) gesellschaftlich relevanten christliche Religion, dessen immanent implizierender Schuldkomplex auf andere nichtreligiöse Bereiche abfärbt. Der Artikel "Wir sind schuld" in der Welt (http://www.welt.de/print/die_welt/kultur/article13824506/Wir-sind-schuld.html) beschreibt das meiner Meinung nach sehr gut.
"Und das Prinzip der gleichen Berücksichtigung gleicher Interessen gebietet es, das Maximum aus ihm herauszuholen. … Gleiche Interessen sind gleich zu berücksichtigen, unabhängig von ihren räumlichen Koordinaten – jeder Mensch ist Teil unserer Gesellschaft. Warum sollte die räumliche Distanz nun einen Unterschied machen?"
Der Sozialismus/Kommunismus ging von einer idealistischen sozialistischen Persönlichkeit aus. Da es diese wie die „klassenbewußte Arbeiterklasse“ so nicht gab, half nur noch die "Diktatur des Proletariats". Der Kapitalismus entsprach den Interessen der real existierenden Menschen (und ihren Bedürfnissen) offenbar weit mehr und war gerade deshalb auch erfolgreicher.
"Vorstellungen von Solidarität mit "unserer" Gesellschaft enthalten implizit oft (nationalistische) Gruppenegoismen, die mit humanistisch-altruistischen Zielen unvereinbar sind."
Der Nationalismus hat sich durch die Fundamentalismen und Kriege im 20. Jahrhundert diskreditiert. Dennoch ist für mich noch nicht erwiesen, daß die Abschaffung des „Nationalen“ die Menschen glücklicher macht und ein besseres Zusammenleben gewährleistet.
Gabriele Röwer am Permanenter Link
Etliche Leser des hpd erinnern sich vielleicht noch an die Gründe der Distanzierung des kritischen Kirchenhistorikers und engagierten Tierschützers Karlheinz Deschner (1924-2014) von Peter Singer im Jahr 2011, zusamme
So sehr Deschner einst Singer, den „father of animals“, geschätzt hatte wegen seiner fundamentalen Kritik am Tier-Mensch-Speziesismus, Spiegel einer jahrtausendealten, auch im folgenreichen „Schöpfungsbefehl“ der Genesis („infernalischer Auftakt der Deformierung eines Sterns zum Schlachthaus“, so Deschner*) zum Ausdruck kommenden Hybris des Menschen („Krone der Schöpfung“) gegenüber dem Tier, so enttäuscht, teilweise entsetzt war er bei näherer Beschäftigung mit einschlägigen Texten Singers angesichts der Konsequenzen seines neuen Konzepts des „Präferenz- oder Interessen-Utilitarismus“, vorbereitet bereits in „Animal Liberation“ von 1975, zugespitzt bald darauf in „Practical ethics“ von 1979.
Indem Singer dort, für Deschner recht willkürlich, ein Kriterium zur Unterscheidung des Lebensrechts verschiedener Wesen einführt, nämlich das der „Person“, deren vorrangige Attribute Selbst- und Zukunftsbewusstsein nebst damit verbundenen Interessen Menschen wie Tiere, die darüber verfügen, abgrenzen von menschlichen wie tierischen „Nicht-Personen“, denen beides fehlt, konstruiert Singer, so Deschner, eine neuerliche Variante der bislang dem dualistischen Monotheismus eigenen selbstherrlichen Hierarchisierung bzw. Dichotomisierung des Lebens. Darin aber nimmt Deschner – wie z.B. der Hirnforscher und Medizin-Ethiker Detlef B. Linke (1945-2005) – einen neuen, einen „Person- bzw. Intellekt-Speziesismus“ wahr, auch inhärent nicht minder fatal als jener von Singer einst bekämpfte „Speziesismus“ im Wortsinn (besonders deutlich in den Kapiteln 5 – „Töten: Tiere“ – und 7 – „Töten: Euthanasie“ der Praktischen Ethik 1984/dt.; 1994/dt. betitelt: „Leben nehmen: Tiere“ bzw. „Leben nehmen: Menschen“).
Deschner sieht in den reflektiven Endlosschleifen dieser Kapitel über erlaubtes und nicht erlaubtes Töten tierischer und menschlicher Wesen je nach ihren Geistesgaben (seltsam vernachlässigt von Verteidigern Singers gegen dessen Kritiker, zuweilen verharmlost als bloße „Gedankenexperimente“) quälend-kasuistisch exemplifiziert, was schon in Animal Liberation (u.a. S. 54) vorgezeichnet war. Daraus folge, dass nun nicht mehr der „Mensch“, sondern die „Person“, ob menschlicher oder nichtmenschlicher Natur, das vom homo rationale diktierte Maß aller Dinge ist. Deschner vermag darin keinen Fortschritt zu sehen gegenüber dem einstigen, von Singer infrage gestellten Anthropozentrismus, nur dass die Trennlinie jetzt nicht mehr vertikal zwischen den Spezies verläuft, sondern horizontal mitten durch sie hindurch.
Für Deschner hingegen gilt: statt das Maß des Lebenswerts eines Wesens abhängig zu machen von seinem uns ähnlichen intellektuellen Reifegrad (dessen „Reife“, zumal bei jenen an den Hebeln der Macht in Wissenschaft und Wirtschaft, nicht selten durchaus bezweifelbar ist…), statt den Rechtsstatus von Tieren (so im Great Ape Project) abhängig zu machen von ihrer Ähnlichkeit mit uns („gleiche Rechte für Gleiche“), sollte, jenseits davon, absolute Priorität im Umgang mit Tieren – und Menschen – das Bewusstsein des ihnen eigenen Schmerzempfindens haben, unabhängig von der jeweiligen neuronalen Ausprägung.
So verdiene jeder Mensch, jedes Tier, da empfindungsfähig, grundsätzlich (wenn auch oft nicht konsequent realisierbar) allen erdenklichen Schutz, sofern wir uns nicht selbst davor schützen müssen. Hier weiß sich Deschner einig mit Denkern wie Schopenhauer und Schweitzer, mit Einstein, H. H. Jahnn und Theodor Lessing (Belege im Essay, s.o.). Mit Jeremy Bentham etwa, englischer Sozialreformer und Begründer des klassischen Utilitarismus, sieht er die Zeit kommen, „in der die Menschheit ihren schützenden Mantel über alles, was atmet, erweitert …“
Wenn nun die drei Autoren dieser „Stellungnahme aus effektiv-altruistischer Sicht“ am Schluss, gegen Singer, im Sinne Deschners, eine Erweiterung des Lebensrechts auch „auf die nicht-menschlichen Tiere“, ja, „auf alle empfindungsfähigen Wesen“ fordern, zugleich aber nur „einige Positionen Singers“ für „philosophisch zweifelhaft“ halten, so verkennen sie m.E., dass, was an diesem, dem präferenz-utilitaristischen Teil von Singers Werk kritisierbar ist, nicht einzelne Züge darin betrifft, sondern dessen zentrale Basis. Aus ihr resultieren zudem schon seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren und nicht erst, wie inzwischen oft hervorgehoben, seit dem NZZ-Interview vom 24.5.2015, folgerichtig all jene Konsequenzen, welche den Atem stocken lassen, nicht schön zu reden durch ihre Deklarierung als bloß „hypothetisch-spekulative Gedankenexperimente“.
Zwei Beispiele dieser stringenten Konsequenzen (keine bedauerlichen, Singers einstigem Denken konträren Auswüchse also), die Deschner empören, mögen abschließend für viele stehen (nachzulesen in o.g. Essay):
Verständnis äußerte der „flexible Veganer“ Singer nicht nur für den Tierverzehr vieler Menschen, sofern die Tiere artgerecht (also nicht industriell) gehalten und schmerzlos getötet werden (so schon in „Animal Liberation“, S. 367), sondern auch für die Überzeugung des Oxforder Neurochirurgen Tipu Aziz, mit Parkinson-Tests an 100 Primaten (entsetzlich qualvoll, da ohne Betäubung während der Experimentierphasen!) 40.000 Menschen helfen zu können (Sunday Times vom 26.11.2006). Das Statement ist zwar „utilitaristisch-logisch“, sofern die „Lust-Leid-Bilanz“ stimmt, die positiven Folgen also die negativen übersteigen. Es lässt indes zum einen den Protest des einstigen „father of animals“ vermissen gegen die Blockierung längst entwickelter Alternativen zu Tierversuchen (vor allem in vitro- und in silico-Verfahren – Untersuchungen an ausgeklügelten menschlichen Zellkulturen, Tests im Reagenzglas, Computersimulationen/Einsatz von Mikrochips etc.) durch die von Tierversuchen Profitierenden; zum andern und vor allem vermissen wir seine Weigerung, Tiere zu benutzen zur Minderung menschlichen Leidens bzw. zur Mehrung menschlichen Glücks, als Mittel also zur Befriedigung unserer Bedürfnisse.
Singers Umkehrschluss aber lehnt Deschner, der das – ihm allein wichtige, wenngleich unterschiedlich ausgeprägte – Schmerzempfinden der Lebewesen betont, nicht minder heftig ab: Um Tieren Qualen zu ersparen, legt Singer, bei Überwindung der „Voreingenommenheit“ von Speziesisten, nahe, Menschen mit einem ähnlichen geistigen Niveau wie bisherige Versuchstiere oder irreversibel hirngeschädigte Kleinstkinder mit einem noch geringeren Niveau (oder senile Menschen!) solchen Qualen auszusetzen. Und dies auch, weil man hierdurch „mehr Informationen über die menschliche Reaktion“ erhalte als in Tierversuchen, deren Anzahl man dadurch „bedeutend reduzieren“ könne („Praktische Ethik“ 1994, S. 97): „Trotz der geistigen Defizite sind Anatomie und Physiologie dieser Kleinstkinder in nahezu jeder Hinsicht mit der normaler Menschen identisch. Würden wir sie also mit großen Mengen Bodenpolitur zwangsernähren [?] oder ihnen konzentrierte Kosmetiklösungen in die Augen tropfen [?], so bekämen wir viel verläßlichere Hinweise auf die Verträglichkeit [?] dieser Produkte beim Menschen als bei der jetzigen Methode“ („Animal Liberation“ 1975, S. 138; auch S. 53).
All dies: „bloß hypothetisch-spekulative Gedankenexperimente“? Wohl kaum! Und wären sie es? Nicht minder entsetzlich!
Deschner lehnt – unterschiedslos – strikt beides ab, Qualen für Tiere genauso wie solche für Menschen, zumal für jene, die nicht autonom entscheiden können. (Die juristisch flankierte Entscheidung autonomer Menschen für den assistierten Suizid hingegen, für ein Sterben ohne Qualen, steht für ihn auf einem andern Blatt, sie findet seinen ungeteilten Respekt.)
Nicht nachvollziehbar sind für Deschner ebenfalls Singers Reflexionen darüber, inwieweit schwerbehinderte Säuglinge – Singer nennt in „Practical ethics“ explizit mit Hämophilie oder Spina bifida Geborene (die ich unterrichtete) sowie Babies mit einem Down-Syndrom (die hohe Emotionalität mongoloider Menschen ist bekannt, meist sehr viel höher als die der Geschwister) – ein Lebensrecht haben sollten oder nicht (vgl. auch das mit Helga Kuhse verfasste Buch „Should the baby
live“, 1985, dt. 1993 – hier wird ganz allgemein als „entscheidend für das Recht auf Leben“ der „Beginn des Lebens einer Person, nicht eines physischen Organismus“ bezeichnet (S. 179). Singers Reflexionen kulminieren in dem oft zitierten Satz: „Der Kern der Sache ist freilich klar: die Tötung eines behinderten Säuglings ist nicht moralisch gleichbedeutend mit der Tötung einer Person. Sehr oft ist sie überhaupt kein Unrecht.“ („Praktische Ethik“ 1984, S. 188; 1994, S. 244; 1985 heißt es bei Singer/Kuhse lapidar: „We think that some infants with severe disabilities should be killed.“ In der „Praktischen Ethik“, Kapitel „Rechtfertigung von Infantizid und nichtfreiwilliger Euthanasie“, merkt Singer zudem an, er konzentriere sich „der Einfachheit halber“ auf Säuglinge, was er über sie sage, lasse sich „auch auf ältere Kinder oder Erwachsene anwenden“, die „auf der geistigen Reifestufe eines Säuglings stehengeblieben sind“ („Praktische Ethik“1984, S.179; 1994, S. 232).
Demgegenüber betonten Freunde Deschners aus dem gbs-Vorstand am 30.5.2011 (analog vier Jahre später nach dem Zürcher Singer-Interview): „Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass JEDER Mensch von Geburt an ein unbedingtes Lebensrecht besitzt – und dabei ist es gleichgültig, ob dieser Mensch in irgendeiner Form behindert ist oder nicht!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Gern schließe ich mich der Hoffnung von Adriano Mannino, Tobias Pulver und Jonas Vollmer aus der GBS Schweiz an (ohne ihren „effektiven Altruismus“ durchweg zu teilen geschweige ihre streckenweise spürbare Sympathie für das m.E. in der Praxis hochfatale Konzept des „Präferenz- oder Interessen-Utilitarismus“), dass Peter Singer in nicht allzu ferner Zukunft sich auf diejenigen Themenbereiche aus seinem Gesamtwerk konzentriert, „bei denen das meiste Leid auf dem Spiel steht“ – Tierleid und Weltarmut. Denn es gibt auf unserem Globus „genug für jedermanns Bedürfnisse“, z.B. Lebensqualität auch der Allerschwächsten, „aber nicht für jedermanns Gier.“ (Gandhi)
* Vgl. Karlheinz Deschners 1998 in der ASKU-Presse (Bad Nauheim, Sven Uftring) erschienene Schrift „Für einen Bissen Fleisch – Das schwärzeste aller Verbrechen“.
Siegfried Bahr am Permanenter Link
Was der Vermehrung des Glücks und Verminderung von Leid sicher abträglich ist, ist diese technische Debatte hier.