Am 21. Februar 2021 wäre John Rawls 100 Jahre alt geworden. Der US-amerikanische Philosoph war der Begründer einer vertragstheoretischen Gerechtigkeitskonzeption. Dabei äußerte er sich zu Fragen, die auch für die Gegenwart noch von großer Relevanz sind.
Am 21. Februar 1921, also heute vor 100 Jahren, wurde der US-amerikanische Philosoph John Rawls geboren. Sein Hauptwerk "Eine Theorie der Gerechtigkeit" (ETdG) erschien 1971, also vor 50 Jahren. Insofern hat man es mit einem doppelten Jubiläum zu tun. Auch wenn Rawls einer der bedeutendsten politischen Philosophen des 20. Jahrhunderts war und als innovativer Wiederentdecker der Vertragstheorien gilt, ist er in Deutschland außerhalb der Philosophie und Politikwissenschaft eher unbekannt. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe: Das erwähnte Hauptwerk ist ein nicht leicht verständlicher, über 600-seitiger Wälzer. Rawls beschäftigte sich sein akademisches Leben in erster Linie damit, seine eigene Gerechtigkeitskonzeption zu begründen und weiterzuentwickeln. Er gehörte nicht zu den engagierten Intellektuellen mit politischer Wirkung, scheute er doch eher das Licht der medialen Öffentlichkeit. Außerdem war Rawls ein bescheidener und schüchterner Mensch, der ungern vor größerem Publikum auftrat, um dort Vorträge zu halten.
Gleichwohl verdient sein Denken dauerhaft Interesse, was mit den Ausführungen zu Grundsatzfragen zusammenhängt, insbesondere zum Gerechtigkeitsverständnis. Dieses bezog sich nicht auf persönliche Einstellungen von konkreten Individuen, denn: "Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei Gedankensystemen. Eine noch so elegante und mit sparsamen Mitteln arbeitende Theorie muss fallen gelassen oder abgeändert werden, wenn sie nicht wahr ist; ebenso müssen noch so gut funktionierende und wohlabgestimmte Gesetze und Institutionen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind" (ETdG, S. 19). Demnach hätte die gemeinte Auffassung von Gerechtigkeit durchaus Konsequenzen, wozu sich für die politische Praxis indessen Rawls nie genauer ausließ. Gleichwohl waren seinen Auffassungen gewisse Folgen eingeschrieben, denn sie ermöglichen eine kritische Einschätzung der gesellschaftlichen Gegebenheiten.
Dies machen die für die Gerechtigkeit postulierten Prinzipien deutlich: "1. Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist. 2. Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offen stehen" (ETdG, S. 81). Während der erste Grundsatz für das gesellschaftliche und politische Leben eigentlich eine Selbstverständlichkeit für den demokratischen Verfassungsstaat ist, löste der zweite Grundsatz hinsichtlich seiner Relevanz für die sozioökonomische Ordnung erheblichen Widerspruch aus. Denn hier wurden bezüglich der Besitzverhältnisse spezifische Legitimationserwartungen von Rawls postuliert. Er beschwor nicht das Gleichheitsideal, sondern wollte auch Ungleichheit zulassen. Wobei dies in der gesellschaftlichen Praxis voraussetzte, dass sie eben "zu jedermanns Vorteil dienen" sollte.
Man findet indessen keinen entwickelten Kriterienkatalog oder Maßstab bei Rawls, womit das Ausmaß und die Folgewirkungen des Gemeinten klarer bestimmbar wären. Daher konnte man den Philosophen schlecht in eine bestimmte Schublade stecken: War er eher ein sozialer Liberaler oder eher ein liberaler Sozialist? Eine Antwort auf diese Frage lässt sich auch mangels Hinweisen auf ein politisches Wirken nicht geben. Denn ein einschlägiges Engagement ist von ihm nicht bekannt, sieht man einmal von seiner öffentlichen Verurteilung des Vietnam-Krieges ab. Bemerkenswert ist aber die bezüglich der Grundsätze betonte Rangordnung: "Diese Ordnung bedeutet, dass Verletzungen der vom ersten Grundsatz geschützten gleichen Grundfreiheiten nicht durch größere gesellschaftliche oder wirtschaftliche Vorteile gerechtfertigt oder ausgeglichen werden können" (ETdG, S. 82). Demgemäß war – im Fall einer solchen Einschätzung – Rawls ein demokratischer Sozialist, eben mit der Betonung der Freiheit vor der Gleichheit in der Prioritätensetzung.
Wie wurden indessen die Gerechtigkeitsgrundsätze von Rawls begründet? Er bediente sich dazu einer kontraktualistischen Argumentation oder anders formuliert: Rawls knüpfte an frühere Vertragstheorien an. Diese gingen etwa bei Hobbes oder Locke davon aus, dass Menschen im Naturzustand für das Ordnungsmodell eines Staates votieren würden. Dabei handelte es sich jeweils um ein fiktives Gedankenexperiment, nicht um historische Vorkommnisse. Bei den genannten Denkern kam es dabei zu unterschiedlichen Ergebnissen: einmal eine autoritäre Herrschaft, die aber den Individuen persönliche Sicherheit brachte, einmal eine demokratische Rechtsstaatlichkeit, die von Gewaltenteilung und Menschenrechten geprägt sein sollte. Beide Ansätze des klassischen Kontraktualismus blendeten aus, dass es auch eine soziale Frage angesichts von ungleicher Güterverteilung gibt und ebendiese Konsequenzen für das soziale Miteinander hatte. Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz von Rawls macht deutlich, dass ihm ein Bewusstsein für eine Gesellschaft prägende sozioökonomische Verfasstheit eigen war.
Ein Gedankenexperiment führte zu den Grundsätzen: ein vorgestellter "Schleier des Nichtwissens". Dieser war von folgender Annahme geprägt: Es kommen rational argumentierte Individuen zusammen, welche nichts über ihren gesellschaftlichen Status wissen. Demnach ist ihnen nicht bekannt, ob sie Arme oder Reiche, Gebildete oder Ungebildete, Männer oder Frauen, Schwarze oder Weiße sind. Für welche Grundsätze, so fragte Rawls, würden sie sich als prägend für ein gesellschaftliches Ordnungsmodell entscheiden? Seine Antwort waren die beiden Gerechtigkeitsprinzipien. Ein Armer würde so von existenter Ungleichheit eben auch Vorteile haben. Ein Reicher könnte seinen Reichtum eben auch noch durch die legitime Ungleichheit mehren. Die im Gedankenexperiment präsenten Individuen müssten insofern gar nicht moralische oder soziale Vorstellungen haben. Sie würden auch durch ihren bloßen Egoismus im Kalkül für den eigenen Vorteil dazu kommen, die Gerechtigkeitsprinzipien im Rawls'schen Sinne aufzustellen.
Insbesondere gegen das Differenzprinzip, das den zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz prägt, wurde dann von den Kritikern häufig Widerspruch vorgetragen. Rawls hatte sich hier auch eines Tricks bedient, dies aber den Lesern gegenüber offen eingeräumt: "Wir möchten den Urzustand so bestimmen, dass die gewünschte Lösung herauskommt" (ETdG, S.165). Gleichwohl stellt sich die Frage, ob Arme wie Reiche, ohne ihren Status zu kennen, nicht durchaus für diese Option votieren würden. Sie schafft Anreize und Sicherheit gleichzeitig. Einwände gab es auch gegen den dem ersten Gerechtigkeitsgrundsatz zugeschriebenen Vorrang. Würden sich alle Individuen für eine solche Prioritätensetzung im "Schleier des Nichtwissens" entscheiden? Wäre ihnen Freiheit in Unsicherheit lieber als Gleichheit in Unterdrückung? Dies sind nur einige Fragen, die berechtigterweise gegen das Gerechtigkeitskonzept von Rawls in einem kritischen Sinne vorgebracht werden können. Sie widerlegen den Ansatz nicht, nötigen aber hier zur Weiterentwicklung.
Besondere Beachtung verdient das Gedankenexperiment trotz der formulierten Kritik. Denn es setzt nicht eine Idealsituation voraus, wobei die Einzelnen moralisch gute Wesen sind. Selbst aus ihrem Egoismus heraus würden sie im "Schleier des Unwissens" für eine egalitärere Verteilungsregelung votieren. Denn es besteht durchaus ein inhaltlicher Legitimationsbedarf für soziale Ungleichheit, zumindest aus der Blickrichtung eines Gesellschaftsbildes, das nicht den Egoismus von Wenigen ins Zentrum stellt. John Rawls' "Eine Theorie der Gerechtigkeit" motiviert Reflexionen über solche Zusammenhänge. Man findet außerdem in dem Buch noch viele weitere Erörterungen zu relevanten Fragen der Gegenwart. Dies gilt etwa für die nur kurzen Ausführungen zum "Zivilen Ungehorsam", die auch in den Protestbewegungen von größerer Relevanz für ihr Wirken sein könnten. Rawls starb bereits 2002. Aufgrund seiner Bescheidenheit wurde seine Stimme öffentlich häufig nicht genug gehört. Kritische Beachtung verdient sein innovatives Werk weiterhin.
Literaturhinweise:
Einführungen und Überblicksdarstellungen sind: Wolfgang Kersting, John Rawls zur Einführung, Hamburg 1993; Thomas W. Pogge, John Rawls, München 1994. Das genannte Hauptwerk ist: Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1975 (oben als ETdG zitiert). Spätere Bücher von Rawls wie Politischer Liberalismus, Frankfurt/M. 1998 und Gerechtigkeit als Fairneß. Ein Neuentwurf, Frankfurt/M. 2003 stellen Weiterentwicklungen dar. Bezogen auf die internationalen Beziehungen erläuterte er seine Gerechtigkeitsvorstellungen in: Das Recht der Völker, Berlin 2002. Und eine erste Begründung der Gerechtigkeitskonzeption findet sich in einem alten Aufsatz von 1958, er liegt als Justice as Fairness/Gerechtkeit als Fairness, Ditzingen 2020 vor. Über seine Auffassungen zu Religion äußerte Rawls sich in zwei Texten in der posthumen Veröffentlichung: Über Sünde, Glaube und Religion, Berlin 2010.

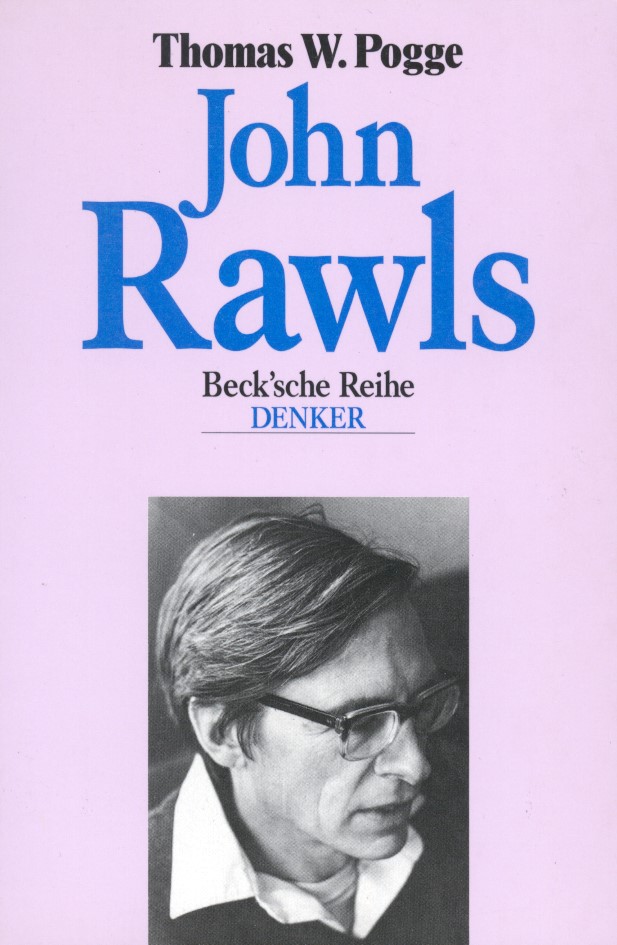



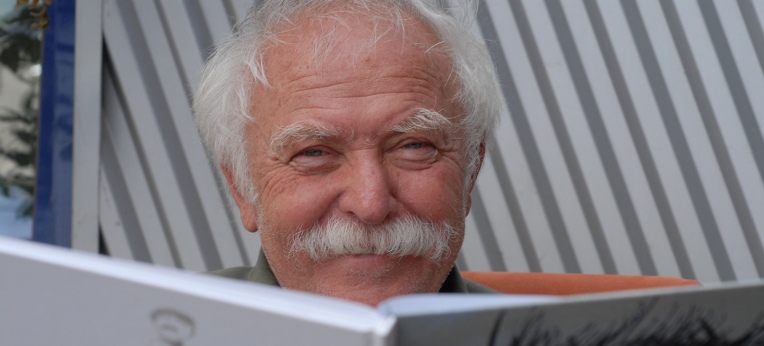



1 Kommentar
Kommentare
A.S. am Permanenter Link
Interessant ist die Trennung von "Gleichheit in den Freiheitsrechten" und der "Gleichheit bzw. Ungleichheit in den materiellen Verhältnissen".
Ist es bei Akkordarbeit gerecht, dass derjenige, der mehr Stück pro Stunde schafft, auch mehr Gehalt bekommt? Hier "Nein" zu sagen, wäre doch höchst ungerecht! Den berechtigten Mehrverdienst nachträglich über eine Besteuerung abzugreifen um ihn der "gerechten" Umverteilung zuzuführen, wäre dem Fleißigen gegenüber höchst ungerecht.
Im Ergebnis wird man meiner Ansicht nach nicht um Bandbreiten für materielle Ungleichheiten herum kommen.