Was 2020 in Deutschland von der CSU unter Horst Seehofer eiskalt abgewürgt wurde, könnte in Österreich zur neuen Realität auf Bundesebene werden. Die grüne Justizministerin legte einen Gesetzentwurf mit Personenbezeichnungen in rein weiblicher Form vor. Die Meinungen in Österreich darüber sind gespalten. Und ist es damit getan oder sollten Gesetze zukünftig "*"-Bezeichnungen enthalten, um auch nicht-binäre Geschlechter einzubeziehen?
Treue Leser*innen des hpd haben vielleicht bemerkt, dass nicht alle Artikel, die der hpd veröffentlicht, gegendert sind. Der Grund dafür ist, dass der hpd den Autoren die Entscheidung frei überlässt, ob und in welcher Form sie gendern wollen.
Den Weg des hpd geht auch der österreichische Gesetzgeber, denn detaillierte Gender-Vorgaben mit Gesetzesrang gibt es in Österreich nicht. Wohl aber enthält ein "Handbuch für Rechtsetzungstechnik Teil 1" Richtlinien für die förmliche Gestaltung von Rechtstexten. Darin heißt es, dass unsachliche Differenzierungen zwischen Frauen und Männern vermieden werden müssen und Formulierungen so gewählt werden sollen, dass sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. Organ- und Funktionsbezeichnungen haben geschlechtsneutral zu sein und in den Fällen, wo dies nicht möglich ist, sollen die weibliche und die männliche Form angeführt werden.
Die legistischen Richtlinien erscheinen ausgewogen, wenn wir vorerst nicht-binäre Personen außer Acht lassen. Das Ziel einer sinnvollen und gendergerechten Formulierung muss es sein, dass sämtliche Geschlechter sprachlich sichtbar werden. Eine gendergerechte Formulierung spricht alle Personen gleichermaßen an und kein Geschlecht bleibt unsichtbar.
Selbst auf die Gefahr hin, Empörung bei einem Teil der Leserschaft auszulösen: Der Entwurf, den die mutige Justizministerin Dr.in Alma Zadić, LL.M. in einer Steilvorlage dem Ministerrat unterbreitet hat, schießt über diese Ziele hinaus. Das Gesetz, das den sperrigen Titel "Flexibles Kapitalgesellschafts-Gesetz" trägt und Start-Ups in der Frühphase ihrer unternehmerischen Tätigkeit eine international wettbewerbsfähige Alternative ermöglichen soll, lässt männliche Personenbezeichnungen gänzlich weg. Wenn ein Gesetzestext nur noch von Notarinnen, Gesellschafterinnen und Arbeitnehmerinnen spricht, dann verstößt das Gesetz offensichtlich gegen die Richtlinien des Handbuchs für Rechtsetzungstechnik, weil die Organ- und Funktionsbezeichnungen nicht mehr geschlechtsneutral formuliert sind und auch nicht beide Formen angeführt werden. Es verwundert daher nicht, dass selbst die Legisten in den "Erläuternden Bemerkungen" zum Gesetzesentwurf die Verwendung der weiblichen Form nicht konsequent durchhalten und gelegentlich aufs Gendern "vergessen".
Die Reaktionen der anderen Parteien fielen so aus, wie es nach aktueller politischer Lage zu erwarten war (vgl. ORF-Bericht). Wenn auch der Koalitionspartner ÖVP und die Oppositionspartei FPÖ den Gesetzesentwurf der grünen Justizministerin äußerst kritisch kommentieren, zeigt sich wieder einmal, dass Parteien über ein kurzes Gedächtnis verfügen oder ihre Wähler*innen für dumm halten. Denn schon 2011 hatte das Bundesland Kärnten unter einem FPK-Landeshauptmann das "Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz" und 2013 das tiefschwarze Bundesland Tirol das "Kinder- und Jugendhilfegesetz" mit jeweils rein weiblichen Formulierungen verfasst. Im Gegensatz zum aktuellen Ministerialentwurf (siehe § 27 FlexKapGG) enthalten diese Landesgesetze jedoch keinen Hinweis darauf, dass die weibliche Form alle Geschlechter gleichermaßen einschließt. ÖVP und Freiheitliche haben also die Männer gänzlich vergessen, während die grüne Justizministerin dies nicht tut.
Die genannten Landesgesetze verdeutlichen, dass den Legisten die Dringlichkeit der Problematik schon lange bekannt ist, jedoch in der Sache wenig vorangeht. Vielleicht führt der neuerliche Anstoß durch die grüne Justizministerin zu mehr als nur einer Sommerlochdebatte und bringt den Stein endgültig ins Rollen. Die bosnisch-stämmige Justizministerin hat sich in der Vergangenheit bereits mehrmals als durchsetzungsfähig erwiesen, und ihr ist auch in dieser Sache Hartnäckigkeit zuzutrauen.
Über die Pros und Contras der Geschlechterinklusion in der deutschen Rechtschreibung wurde viel diskutiert, die Argumente der Befürworter und Gegner sind allgemein bekannt. Faktum bleibt aber weiterhin, dass die Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Menschen der Ansicht ist, dass im Deutschen die männliche Form auch die Frauen inkludiert, während die ausschließliche Verwendung der weiblichen Form die Männer nicht einschließt. Die Linguisten nennen diese Fähigkeit maskuliner Personenbezeichnungen, geschlechtsabstrahierend verwendet zu werden, "generisches Maskulinum".
Ob das Sommerloch-Manöver der österreichischen Justizministerin die richtige Antwort auf inhärente Ungleichbehandlung der deutschen Sprache ist, muss angezweifelt werden. Männliche Personenbezeichnungen absichtlich aus dem Wortlaut von Rechtstexten zu verdrängen, ist jedenfalls kein Leuchtturmprojekt zur Förderung der sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter. Da aber Frauen nicht mehr länger nur in männlichen Formulierungen "mitgemeint" sein wollen und viele Männer dagegen rebellieren, zu einem bloßen Anhängsel eines sprachlich hypergekünstelten und staatlich verordneten "generischen Femininums" degradiert zu werden, bleibt die Frage, welche Möglichkeiten ein redlich bemühter Legist bei der Gesetzesformulierung hat.
Die Antwort darauf könnte möglicherweise in der Rücksichtnahme auf nicht-binäre Personen liegen, die ebenfalls ihr Recht auf Sichtbarkeit einfordern dürfen. Sowohl deutsche als auch österreichische Gerichte haben längstens entschieden, dass Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, nicht diskriminiert werden dürfen. Um langfristige Gleichbehandlung aller Geschlechter zu erreichen, sollte daher die Verwendung von Asterisk ("Gender-Stern"), Unterstrich ("Gender-Gap") oder Doppelpunkt in Erwägung gezogen werden. Die ausschließliche Verwendung von zum Beispiel "*" würde keine Person diskriminieren, da keine Geschlechtsform bevorzugt sichtbar wäre, und somit würden alle Geschlechter gleichbehandelt.
Jedoch dürfen auch die Bedürfnisse bestimmter Minderheiten nicht vergessen werden: Blinde und sehbehinderte Personen empfinden den Asterisk in der digitalen Anwendung barrierefreier und gebrauchstauglicher als den Doppelpunkt (vgl. Studie der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik). Viele Erwachsene sind nicht in der Lage, selbst einfache Texte zu lesen oder zu schreiben, was berücksichtigt werden muss. Die Möglichkeit des Deutschlernens für Migranten sollte durch Gendermaßnahmen nicht erschwert werden.
Es ist also keineswegs einfach, eine für alle Personen zumutbare Lösung zu finden. Der Rat für deutsche Rechtschreibung wäre als zwischenstaatliches Gremium, das damit betraut ist, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschsprachigen Raum zu bewahren, die geeignetste Einrichtung, sich mit all diesen Fragen intensiv zu beschäftigen und den Regierungen Vorschläge zu unterbreiten. Nur spricht sich der Rat explizit gegen die Verwendung von Kurzformen zur Kennzeichnung mehrgeschlechtlicher Bezeichnungen aus: "Ihre Nutzung innerhalb von Wörtern beeinträchtigt daher die Verständlichkeit, Vorlesbarkeit und automatische Übersetzbarkeit sowie vielfach auch die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten. Deshalb können diese Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in das Amtliche Regelwerk aufgenommen werden."
Apropos Lesbarkeit und Verständlichkeit: Im österreichischen "Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS)" werden alte, aber immer noch gültige Gesetze in der Schreibweise der österreichischen Monarchie wiedergegeben. Sonderliche Bedenken ob der Unverständlichkeit antiquierter Schreibweisen hat Österreich diesbezüglich nicht.
Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist also keine Hilfe, aber vielleicht zeigt das RIS auf, wie es mit dem Gendern in Rechtstexten weitergehen könnte. Das RIS ist für Österreicher*innen faktisch die wichtigste Quelle für Normen und Judikate. Aber die neue deutsche Schreibweise, zum Beispiel in der Darstellung des ehrwürdigen ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) aus dem Jahr 1812, wird konsequent von den RIS-Betreibern ignoriert. Seit vielen Jahrzehnten decken sich gesprochenes und geschriebenes Wort nicht mehr. Es ist also nicht gänzlich abwegig, daran zu denken, in der Zukunft generell zwischen Umgangssprache und Normtext zu unterscheiden. Die Menschen könnten weiterhin reden, wie sie es gewohnt sind, aber in amtlichen Werken wird beispielsweise der Gender-Stern verwendet. Daran könnten sich die Menschen im deutschsprachigen Raum gewöhnen. Ob sie schon dazu bereit sind, ist eine andere Frage.







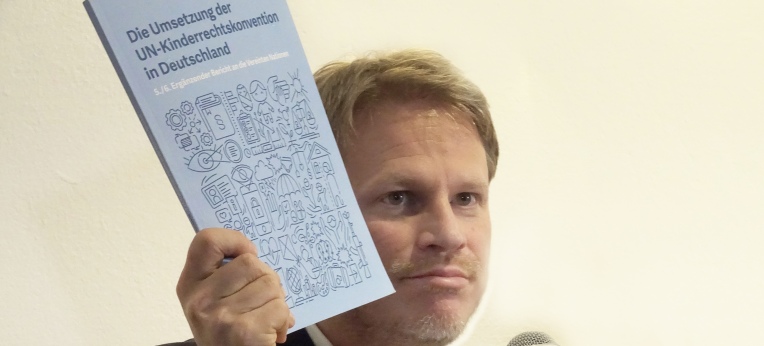
8 Kommentare
Kommentare
malte am Permanenter Link
„Das Ziel einer sinnvollen und gendergerechten Formulierung muss es sein, dass sämtliche Geschlechter sprachlich sichtbar werden.
Wieso ist es so wichtig, dass beide Geschlechter „sichtbar“ sind? Man kann natürlich argumentieren, dass beim generischen Maskulinum („Treue Leser“) Frauen „unsichtbar“ sind. Es ist bei dieser Formulierung ist aber ganz schön viel „unsichtbar“. Ob die Leser schwarz, weiß oder asiatisch sind, ob alt oder jung, ob behindert oder nicht, ob durchschnittlich groß oder kleinwüchsig – alles das ist „unsichtbar“. Was ist am Merkmal „Geschlecht“ so wichtig, dass es permanent „sichtbar“ gemacht werden muss? Das hat mir noch kein Anhänger des Sternchen-Wesens erklären können.
Balázs Bárány am Permanenter Link
Danke für diese detaillierte Betrachtung des Themas!
Das sind gute Vorschläge.
Klaus D. Lubjuhn am Permanenter Link
GENDERSTREIT
Wer in diesen Genderfragen nicht ins Fettnäpfchen treten will, ist gut beraten, Fragen zu stellen.
Im Fokus steht die Ausgangsfrage:
Letzteres nimmt für sich in Anspruch, Frauen zu inkludieren ( nicht: mitzumeinen) und steht grundsätzlich offen für Gender - Ansprüche aller Art.
Angesichts heftiger Konfrontation zwischen binären und genderartigen Sicht - und Sprechweisen wäre ein gesellschaftspolitischer Kompromiss zu suchen, der die diversen Ansprüche bündelt. Leicht gesagt, schwer getan.
Geht es um Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit in kommunikativen Sprechsituationen - in denen der Geschlechterinklusion gemäß Genderimperativen entsprochen wird - werden aktuell neue "Geschlechter" - Zeichen für unbedingt erforderlich erachtet: Asterik z.B.
Was bisher an neuen Zeichen zur inklusiven Bezeichnung vorliegt, deckt nach Experten - Auskunft in vielerlei Hinsicht die unterschiedlichen Ansprüche an Sprache und Sprechen nicht ab.
Asterik und andere Zeichen werden als Lesehindernisse wahrgenommen, bergen zugleich Verständnisfallen - zumal für Nicht - Muttersprachler.
Das Urproblem der Gendergerechtigkeit - das generische Maskulinum - birgt aber m.E. zugleich die Lösung.
Geht es um Pauschalinklusion gemäß der Genderimperative ist vielleicht ein Kompromiss über ein Kompensationsangebot, quasi eine Komplementärfunktion des generischen Maskulinums hilfreich.
Bevorzugt wird von einigen Autoren im wissenschaftlichen Schrifttum ein Wechsel zwischen männlichen und weiblichen Formen. Das mag für Muttersprachler funktionieren, nicht aber für Sprecher/ Leser anderer Muttersprachen.
Nach Genderimperativ soll der Asterik als Komplementärzeichen fungieren, um das vermeintliche Desiderat pauschal inkludierender Zeichen in der Gebrauchssprache zu beheben. Warum - so ist zu fragen - versucht die die Genderimperative propagierende Politik (in staatlicher Exekutive und auf Genderlehrstühlen) nicht selbst einen Kompromiss zu generieren? Da es kein generisches Feminum gibt, scheidet die österreichische Initiative aus.
Könnte denn das generische Maskulinum nicht als ein mit Genderimperativen ganz neu ausgezeichnetes Zeichen verstanden werden und dessen Verwendung explizit als gender - inkludierend politisch proklamiert werden?
Der Asterik selbst hat doch selbst (nur) Zeichencharakter, ein Zeichen, das zuerst einmal als Gender - Pauschalinklusion verstanden und eingeführt werden müsste. Bedarf der Gender - Asterik nicht genauso der Akzeptanz wie aktuell das infragestehende generische Maskulinum? Was aber, träte nun das alte generische Maskulinum mit neuartigem Genderanspruch auf und an? Man bedenke: Der Genderasterik wird nicht etwa durch die mit ihm verbundene Inklusionserwartung Wirklichkeit. Umfassende Inklusion selbst ist ein historischer Schritt. Allein bei performativen Äußerungen gilt das Aussprechen zugleich als Handlungswirklichkeit. Der Asterik - An - und Ausspruch auf umfassende Inklusion folgt aber nicht der Performanz. Das generische Maskulinum aber ist in der Gebrauchssprache bereits präsent, ist bereits gesprochene Wirklichkeit. Eigentlich bräuchte man doch dieser Sprach- bzw. Sprech -Wirklichkeit doch nur das Genderkleid überzustreifen.
Fazit: In der bloßen Umkehrung des binären Codes - jetzt also im Versuch, generisches Femininum zu fordern und darin das Heil im Gender akzentuierten “Geschlechter” - Kampf zu suchen, erinnert an Performanz - Illusion.
Gruß aus Aachen
Klaus D. Lubjuhn
David Z am Permanenter Link
Gender-motivierte Sprachakrobatik ist in Gesetzestexten selbstverständlich abzulehnen. Es gibt nur eine Referenz, und das ist die deutsche Rechtschreibung.
"Das Ziel einer sinnvollen und gendergerechten Formulierung muss es sein, dass sämtliche Geschlechter sprachlich sichtbar werden."
Warum?
"Eine gendergerechte Formulierung spricht alle Personen gleichermaßen an und kein Geschlecht bleibt unsichtbar."
Warum müssen Geschlechter sichtbar gemacht werden, wenn sie im Kontext nicht die geringste Rolle spielen?
"Die genannten Landesgesetze verdeutlichen, dass den Legisten die Dringlichkeit der Problematik schon lange bekannt ist, jedoch in der Sache wenig vorangeht. "
Welche Dringlichkeit?
"Faktum bleibt aber weiterhin, dass die Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Menschen der Ansicht ist, dass im Deutschen die männliche Form auch die Frauen inkludiert, während die ausschließliche Verwendung der weiblichen Form die Männer nicht einschließt."
Genau. Was für eine elegante Lösung, nicht wahr?
"...die richtige Antwort auf inhärente Ungleichbehandlung der deutschen Sprache ist,"
welche "inhärente Ungleichbehandlung"? Was genau ist am oben erwähnten, simplen Konzept des generischen Maskulinums nicht zu verstehen?
"Da aber Frauen nicht mehr länger nur in männlichen Formulierungen "mitgemeint" sein wollen ."
Wie kommen Sie darauf? Sie sagen doch selber, dass die Mehrheit der Bevölkerung mit unserem rechtschreibkonformen Sprachgebrauch kein Problem hat. Würden alle Frauen, also 50% der Bevölkerung, hier ein Problem sehen, käme man nicht auf das oben genannte Ergebnis.
"Die Antwort darauf könnte möglicherweise in der Rücksichtnahme auf nicht-binäre Personen liegen, die ebenfalls ihr Recht auf Sichtbarkeit einfordern dürfen."
Wie kommen Sie darauf, dass das generische Maskulinum irgend etwas etwas mit biologischen Geschlechtern zu tun hätte.
"Sowohl deutsche als auch österreichische Gerichte haben längstens entschieden, dass Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, nicht diskriminiert werden dürfen. "
Selbstverständlich sollten wir Menschen nicht diskriminieren. Das hat aber herzlich wenig mit der Attacke auf das generische Maskulinum zu tun. Im Gegenteil, das generische Maskulinum schließt per Definition doch grade alle Menschen ein, auch jene, die sich als non-binär sehen.
"Um langfristige Gleichbehandlung aller Geschlechter zu erreichen, sollte daher die Verwendung von Asterisk ("Gender-Stern"), Unterstrich ("Gender-Gap") oder Doppelpunkt in Erwägung gezogen werden. Die ausschließliche Verwendung von zum Beispiel "*" würde keine Person diskriminieren, da keine Geschlechtsform bevorzugt sichtbar wäre, und somit würden alle Geschlechter gleichbehandelt."
Nein. Das sehe ich wie die Mehrheit komplett anders. Wir schaffen Probleme, wo keine sind.
Gerhard Baierlein am Permanenter Link
Ja David Z, die Welt hat wesentlich schwerwiegendere Probleme als diesen sinnfreien Geschlechterkampf.
M.S. am Permanenter Link
Volle Zustimmung. Geschlechter zu nennen, wo es im Kontext keinen Sinn ergibt, irritiert mich tatsächlich immer wieder.
Ach ja, und ich bin übrigens eine Frau und gehöre zu dem Teil der Bevölkerung, der überhaupt keine Probleme mit dem generischen Maskulinum hat. Ganz im Gegenteil.
Sandrin am Permanenter Link
Mich nervt das ständig unzufriedene, unterdrückte und mehrfachbelastete Geschlecht tierisch. Ich mein, irgendwo im Leben sollten sich diese behaupteten Nachteile auch statistisch niederschlagen, oder?
Was vielfach gefordert wird, ist Gleichstellung, eine Gleichberechtigung ist in Ö verfassungsmäßig garantiert. Eine Gleichstellung stellt einen Nachteilsausgleich dar, die Menschen mit Behinderung gewährt wird. Das kann etwa durch die Anerkennung eines Pflegegrads sein oder eben, dass ihm mehr Urlaubstage zustehen. Kann man fordern, aber mit Behinderten möchten sie dann doch nicht imselben Satz genannt werden.
Aber eigentlich geht es hier um die angebliche Benachteiligung durch Sprache. Dafür gibt es ebenso wenig Anhaltspunkte, aber OK.
Das grammatische Geschlecht ist unabhängig vom sexuellen und konnte schon auch zuvor auch weiblich sein. Dafür gab es jedoch regeln und wer die kannte, konnte wunderbar schreiben oder lesen.
Was ist denn am Mitgemeintsein bitte so schlecht? Wie würde es wirken, wenn in einer Stellenausschreibung auch Dunkelhäutige zur Bewerbung eingeladen werden würden? Eben. Das ist selbstverständlich und in einem Staat wie Österreich auch verfassungsrechtlich verbrieft.
Ich möchte meinen Job als Sachbearbeiterin (ja, ich bin eine Frau) aufgeben, weil ich Texte nicht mehr mit Search&Replace systematisch überarbeiten kann.
Ich glaube, wir haben zu viele arbeitslose Studenten aus gutem Hause, die sich zu schade sind zu pflegen oder putzen zu gehen, und bei denen es fürs Medizin- oder Jusstudium nicht gereicht hat. Im Deutschkurs kann sich die Ali nicht darauf ausreden, dass ihr Mutter sich als Mann fühlt und ihm einen Mädchennamen gegeben hat. Nicht bestanden. Aber der Ann-Sophie ist progressiv und darf uns als Ewiggestrige brandmarken.
DS am Permanenter Link
"... dass den Legisten die Dringlichkeit der Problematik schon lange bekannt ist ..."
Und btw: Nur noch absurd ist inzwischen auch der ubiquitäre Anti-Diskriminierungsfetisch. Zu diskriminieren ist zunächst mal eine elementare Leistung aller Lebensformen; und ich persönlich werde auch weiterhin zwischen "ich/du" oder "wir/sie" unterscheiden - Wertung, Ablehnung, Abgrenzung inbegriffen.