Die AfD wird mit 12,6 Prozent der Stimmen als drittgrößte Fraktion in den Deutschen Bundestag einziehen. Dies ist erschreckend, aber beileibe kein Weltuntergang. Statt in Hysterie auszubrechen, wäre es angebracht, aus dem Wahlerfolg der AfD die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ein Kommentar von Michael Schmidt-Salomon.
Eine streng konservative, christlich-nationale Partei wie die AfD, die den Schwangerschaftsabbruch verbieten will und auf die "Leistungen der deutschen Soldaten im 2. Weltkrieg" stolz ist (AfD-Spitzenkandidat Gauland), hätte in Deutschland normalerweise kein Wählerpotential von über 10 Prozent, ja, eigentlich müsste sie damit rechnen, an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Dass es dazu nicht gekommen ist, hat Ursachen, die auf der Hand liegen, aber in der politischen Debatte nicht hinreichend diskutiert werden.
Einer der entscheidenden, aber kaum thematisierten Gründe für den Erfolg der AfD lässt sich aus zwei Umfrageergebnissen ableiten, die infratest dimap am Wahlabend veröffentlicht hat. Das erste Ergebnis besagt, dass 60 Prozent der AfD-Wähler für ihre Partei stimmten, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind – nicht, weil sie vom Wahl-Programm der AfD überzeugt waren. Das zweite Umfrageergebnis ist nicht weniger aufschlussreich: 92 Prozent der AfD-Wähler zeigten sich besorgt darüber, dass der Einfluss des Islam in Deutschland größer werde, ganze 99 Prozent der AfD-Wähler schätzen es besonders an ihrer Partei, dass sie diesen Einfluss zurückdrängen will.
Die Angst vor dem politischen Islam
Man kann an diesen Ergebnissen erkennen, dass der Erfolg der AfD nicht zuletzt eine Quittung dafür ist, dass alle anderen Parteien die notwendige Debatte über den politischen Islam nicht hinreichend geführt, schlimmer noch: die Debatte den Rechtspopulisten überlassen haben. Die AfD-Strategen haben diese Lücke geschickt genutzt. Nicht ohne Grund trug ihre wohl wichtigste Broschüre im Wahlkampf den Titel "Der Islam gehört nicht zu Deutschland". In diesem Zusammenhang muss man den etablierten Parteien vorwerfen, dass sie durch die Bagatellisierung des Themas "politischer Islam" sowie die schnelle Gleichsetzung jeglicher Form von Islamkritik mit "Rassismus" oder "Faschismus" erst den Nährboden für die AfD geschaffen haben, die viele Wählerinnen und Wähler an sich binden konnte, obgleich diese mit den sonstigen Zielen der Partei wenig anfangen können.
Dies gilt insbesondere für Menschen im Osten, die nicht nur mit dem Islam, sondern mit Religionen im Allgemeinen nicht viel anfangen können – und die nun tragischerweise mit der christlich-patriotisch argumentierenden AfD den Bock zum Gärtner gemacht haben. Es gilt aber auch für viele gut integrierte, säkular denkende Migrantinnen und Migranten aus islamischen Ländern, die die AfD gewählt haben, weil aus ihrer Sicht alle anderen Parteien blind sind gegenüber den massiven Bedrohungen der Freiheit, die vom politischen Islam ausgehen.
Letztlich ist mit dem Wahlerfolg der AfD genau das eingetreten, was ich vor eineinhalb Jahren in meinem Buch "Die Grenzen der Toleranz" prophezeit habe: "Wer etwas so Offenkundiges wie die Realität des politischen Islam leugnet, wer wider alle Vernunft den Zusammenhang von Islam und Islamismus bestreitet, wer meint, man müsse bloß Terroristen bekämpfen, nicht aber die Ideologien, die sie zum Terror motivieren, der treibt die Wählerinnen und Wähler geradewegs in die Arme von Politikern, die ihre antiaufklärerischen Ziele unter dem Deckmantel einer "aufgeklärten Islamkritik" wunderbar verbergen können." (Die Grenzen der Toleranz – Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen müssen, Piper 2016, S. 60)
Die Internationale der Nationalisten
Die AfD ist Teil eines internationalen Netzwerks, das Steve Bannon, der einstige Chef-Stratege von Donald Trump, einmal als "globale Tea Party-Bewegung" bezeichnet hat. Wesentliches Element dieser politischen Bewegung ist eine massiv forcierte Identitätspolitik, die religiös-patriotische Werte zur Abgrenzung der eigenen Gruppe gegenüber "den Anderen" nutzt. Der sozialpsychologische Mechanismus, der dahinter steckt, ist leicht zu durchschauen: Wenn Menschen aufgrund einer verfehlten Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik den Eindruck haben, als Individuen nicht mehr wahrgenommen zu werden, neigen sie dazu, sich als Mitglieder einer Gruppe zu definieren. Gibt man ihnen dazu dann auch noch das passende Feindbild, etwa "die Muslime", kann man aus solchen Ängsten leicht politisches Kapital schlagen.
Steve Bannon hat im Jahr 2014, als er die "globale Tea Party-Bewegung" bei einer Konferenz im Vatikan (!) skizzierte, diese Bewegung nicht nur in christlichen Ländern verortet, sondern auch in Indien, wo mit der radikal-hinduistischen "Bharatiya Janata Party", die die Angst vor "den Muslimen" ebenfalls kräftig schürt, die größte rechtspopulistische Partei der Welt an der Macht ist. Hätte Bannon ein Stückchen weiter geschaut, hätte er einräumen müssen, dass die religiös-nationalistische Strategie, die er 2016 im US-Wahlkampf umsetzte, jenseits des weltanschaulichen Grabens, nämlich in der islamischen Welt, längst angewandt wird. Im Grunde wäre der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan ein leuchtender Repräsentant der "globalen Tea Party-Bewegung" – würde er nicht das falsche Land und die falsche Religion vertreten.
Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren eine weltumspannende "Internationale der Nationalisten" gebildet, die in den einzelnen Ländern mit unterschiedlichen konfessionellen Schwerpunkten auftritt: katholisch in Polen, Ungarn und Frankreich; protestantisch in den USA, in England und der Schweiz; orthodox in Russland, Griechenland und Serbien; sunnitisch in der Türkei, in Ägypten und Saudi-Arabien; schiitisch im Iran, im Irak und in Syrien. In vielen dieser Länder sind religiös-nationalistische Identitätspolitiker an der Macht. In Deutschland sieht dies erfreulicherweise noch immer deutlich anders aus: Obgleich die AfD nahezu die gleiche Strategie anwandte, die Bannon und Trump nutzten, um die Präsidentschaftswahl in den USA zu gewinnen, konnten die Rechtspopulisten in Deutschland nicht einmal 13 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen, 87 Prozent der Wählerinnen und Wähler blieben davon gänzlich unbeeindruckt.
Die richtigen Schlüsse ziehen
Nicht weniger erfreulich ist, dass laut infratest dimap mehr als die Hälfte, nämlich 55 Prozent der AfD-Wähler an ihrer eigenen Partei kritisierten, sie distanziere "sich nicht genug von rechtsextremen Positionen". Das bedeutet: Würden die anderen politischen Parteien ihre Hausaufgaben besser erledigen (wie gesagt, 60 Prozent der AfD-Wähler waren nicht vom Wahlprogramm überzeugt!), ließe sich der Stimmenanteil der AfD leicht auf weniger als die Hälfte des jetzigen Wahlergebnisses reduzieren. Übrig bleibe dann nur noch der harte Kern derer, die wirklich für streng konservative, christlich-patriotische Werte einstehen, Menschen etwa wie Alexander Gauland oder Beatrix von Storch, die sich von der CDU unter der Führung von Angela Merkel nicht mehr vertreten fühlen.
Letztlich ist auch dies eine erfreuliche Nachricht, zeigt sie doch an, wie sehr sich die Christdemokraten in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt haben: Denn offenkundig existiert die AfD (gemeint ist hier deren harter Kern, der vielleicht 5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen könnte) nur deshalb, weil die Prinzipien der Weltoffenheit mittlerweile auch in der CDU (in abgeschwächter Form sogar in der CSU!) angekommen sind und einige ihrer führenden Repräsentantinnen und Repräsentanten heute Positionen vertreten, die vor 25 Jahren selbst die progressivsten Sozialdemokraten kaum öffentlich geäußert hätten.
Es ist zu hoffen, dass die politisch Verantwortlichen aus dieser Erkenntnis die richtigen Schlüsse ziehen. So wäre es ein fataler Fehler, würde die CDU/CSU angesichts des Wahlergebnisses eine Rolle rückwärts machen und die "rechte Flanke" schließen, wie es Horst Seehofer vorschlägt. Denn erstens würde dies mit noch höheren Stimmverlusten bestraft werden (nicht ohne Grund musste die konservativere CSU größere Wählereinbußen hinnehmen als ihre weltoffenere Schwesterpartei). Zweitens würde eine solche "Rolle rückwärts" gesellschaftspolitisch schweren Schaden anrichten. Denn eine Partei, die sich als "Volkspartei" begreift, sollte nicht den Vorstellungen einer kleinen Minderheit folgen, die der gesellschaftlichen Entwicklung um Jahrzehnte hinterherhinkt.
Die stramm auf christlich-patriotische Werte ausgerichtete CDU/CSU der 50er und 60er Jahre ist längst Vergangenheit – und nur sehr wenige Wählerinnen und Wähler wünschen sich diese Zeit zurück! Diejenigen allerdings, die dies tun, sollten im Parlament als eigenständige politische Kraft erkennbar sein. Dies mag unangenehm sein, ist aber besser, als wenn sie von innen her den Kurs einer Regierungspartei bestimmen. Klar ist doch: Wer die sozialen, ökologischen, ökonomischen und kulturellen Herausforderungen der Gegenwart meistern will, muss nach zukunftsfähigen Lösungen suchen – und das Allerdümmste, was man in diesem Zusammenhang tun könnte, wäre es, sich ausgerechnet an jenen zu orientieren, die wie Alexander Gauland mit den beschleunigten Veränderungszyklen der globalisierten Welt nicht Schritt halten können und sich aus diesem Gefühl der Überforderung heraus in die "gute alte Zeit" zurückwünschen.
Ewiggestrige wie Gauland sind nicht in der Lage, zukunftsfähige Politik zu machen. Ganze 87 Prozent der Deutschen haben dies erkannt – und wenn die etablierten Parteien es nicht verbocken, werden es bei der nächsten Wahl noch einige Prozentpunkte mehr sein. Insofern war der Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl keine Tragödie, sondern vielmehr eine Chance für die etablierten Parteien, die endlich erkennen sollten, dass sie sehr viel mehr noch tun könnten, um die offene Gesellschaft gegen ihre Feinde zu verteidigen.





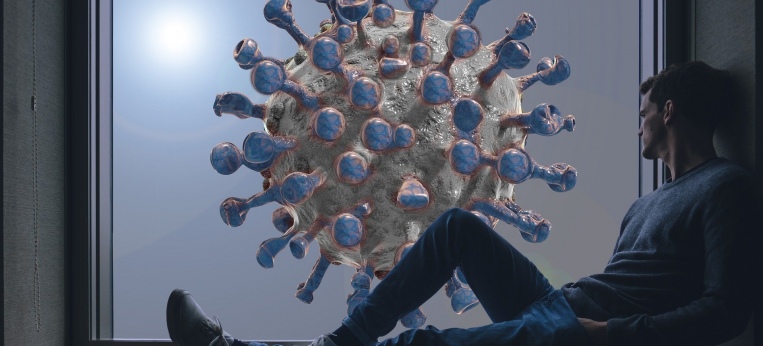


70 Kommentare
Kommentare
Hans Trutnau am Permanenter Link
Der Bock geht als Gärtner in der offenen Gesellschaft hausieren - er wird sich überfressen, hoffe ich.
Tom am Permanenter Link
"Man kann an diesen Ergebnissen erkennen, dass der Erfolg der AfD nicht zuletzt eine Quittung dafür ist, dass alle anderen Parteien die notwendige Debatte über den politischen Islam nicht hinreichend geführt, sch
Kann man das? Wirklich? Möglich wäre auch, dass Medien, Publizisten und Journalisten durch ihr ständiges Lamentieren ein Problem größer machen, als es in Wirklichkeit ist?
Bernd Kammermeier am Permanenter Link
Ich stimme voll zu, Michael.
Bzgl. der 87% AfD-Verweigerer ist sogar noch anzumerken, dass diese 87% bei dieser Wahl relativ mehr Wähler waren, als 87% vor vier Jahren, weil die Wahlbeteiligung ja gestiegen ist. Die AfD hat also Wahlverweigerer (aus den von dir angeführten Gründen) aus der Reserve gelockt und motiviert, überhaupt wählen zu gehen.
In Bezug auf deinen Kommentar muss ich an Thomas Strobl (CDU) denken, der einst recht forsch "christliche Werte" vortrug, wegen derer man Flüchtlingen helfen solle - und nannte die AfD deshalb "Atheisten für Deutschland".
Ich wünsche mir für Deutschland eine Regierung, die wirklich aufwacht und nicht immer weitere Fahnen in den Wind hängt, um sich nach deren Drehrichtung zu orientieren.
Eine Regierung, die auch Unpopuläres entscheidet, wenn das den Weg in die Zukunft - die Zukunft der Welt - ebnet.
Ich wünsche mir Medien, die die Parteien bei dieser Aufgabe stellt, wenn sie versagt und lobt, wenn sie es verdient hat.
Ich wünsche mir Talkshows, in denen noch mehr Position bezogen wird gegen offensichtlich Undemokratisches, Unmenschliches und eindeutig Falsches. Politiker und Medienvertreter müssen Farbe bekennen und zeigen, dass es ihnen nicht um Posten und Pöstchen, um Prozentpunkte und Prozentpünktchen geht - als Erfüllungsgehilfen von Lobby-Gruppen -, sondern um die Zukunft, die genau jetzt in dieser Sekunde beginnt - und nicht erst in der folgenden Legislatur.
Dann kann man Wähler zurückgewinnen für den demokratischen Weg, auch bisherige Nichtwähler. Die einzige brauchbare Alternative für Deutschland sind keine Populisten, Rassisten und Demokratiefeinde, sondern aufrichtig demokratische und zukunftsorientierte Parteien und Politiker.
Mit der AfD sitzt die falsche Alternative bereits sicher im nächsten Bundestag.
Seit gestern läuft der Countdown für die Runderneuerung jener politischen und medialen Landschaft, die die Menschen eigentlich wollen, weil sie sie als Alternative zu dem teilweise trögen Politzirkus der Gegenwart akzeptieren können. Helfen wir alle nach Kräften mit...
Heinrich Zimmermann am Permanenter Link
Ich glaube nicht das die AfD die falsche Lösung ist, nein, die befeuert den echten Disput, was Demokratie braucht. Nur immer Mamma Merkel anhimmeln, geht letztlich ins Totalitäre.
Bernd Kammermeier am Permanenter Link
Was den Disput betrifft, stimme ich Ihnen zu. Allerdings wäre mir dies eine zu enge Auslegung dessen, was eine Partei im Deutschen Bundestag leisten sollte.
Aber was regen wir uns auf. Diese Partei hat schon mit ihrer Erosion begonnen. Frau Petri hat ihre Wähler verarscht und versucht jetzt, vier Jahr lang Werbung für ihre neue Partei der Besoffenen - die Blauen - vom Rednerpult des Bundestages aus zu machen. Andere werden folgen, denn in dieser Partei der verantwortungslosen Egomanen ist sich jeder der Nächste und seine eigene Partei. Wer die in vier Jahren wiederwählt ist selbst Schuld...
Joseph Wolsing am Permanenter Link
Es ist eine fatale Entwicklung, wenn die Angst, zum Leitthema wird.
Die rationale Betrachtung dieses Gedankens ist nicht ausreichend. Sie ignoriert den Faktor Mensch, also den irrationalen Anteil daran, derartiges akzeptabel zu finden.
Die Aufforderung an die etablierten Parteien sie sollten das Thema politischer Islam realistischer anpacken, zugleich aber nicht am rechten Rand fischen, ist eben jener Widerspruch in sich, der die Etablierten insgesamt weiter nach rechts driften lässt.
Wer vergisst weshalb wir Deutsche ein Asylrecht haben - das zwar mittlerweile bis zur Unkenntlichkeit durch Zusatzregelungen verdreht wurde - weil wir vor noch nicht einmal 80 Jahren Millionen von Flüchtlinge erzeugt haben. Für viele die damals z.B. an der Grenze zur Schweiz strandeten, bedeutete dies den Tod. Wenn wir also heute vergessen, weshalb wir solch ein Recht auf Asyl haben und auch noch vergessen, dass wir hier Recht ohne Ansehen der Herkunft der Person sprechen, dann sind all die Werte, auf die wir so stolz sind, das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen.
Nein, es kann nicht sein, dass wir schon wieder die Schuld für unser eigenes soziales Versagen außerhalb der eigenen Gesellschaft suchen.
Rationale Gründe scheinen hier nicht überzeugend zu sein. Bei ca. 890 000 tatsächlich hier lebenden Flüchtlingen, in einer wirtschaftlich hervorragenden Situation, solch eine Furcht vor diesen Menschen zu haben ist nicht rational. Wie auch bei Themen wie dem Klimawandel scheint es so zu sein, dass das rationale Argument, die Daten und Fakten keine Rolle spielen.
Können wir mit der Funktionseise unserer Demokratie einverstanden sein?
Ich denke ja - wenn es der Politik gelingt die AfD zur Wirkungslosigkeit zu verdammen. Wenn eine Regierung ohne die AfD gebildet wird und es gelingt, sie auch in der Opposition nicht die stärkste Kraft sein zu lassen, dann hat die deutsche Demokratie alles richtig gemacht. Dann hat sie nämlich das gezeigt, auf was auch die Richter in Karlsruhe gesetzt haben - eine Resilienz gegen die Übernahme der Kontrolle in Berlin durch die extremen Randgruppen, hier die Rechten. Und dann sind auc hdie Kosten gerechtfertigt, die das ganze verursachen wird.
Die 10 bis 15% rechtsnationaler Menschen in Deutschland hat es auch schon vor der AfD gegeben und sie werden auch noch da sein, wenn die AfD bereits wieder politische Geschichte ist. Damit müssen wir dauerhaft zurande kommen, da liegt das Potential in unserer Gesellschaft, all die Dinge zu tun, die an rechtslastiger Gesllschaft so hässlich sind und die eigentlich auch in den Mülleimer der Geschichte gehören, Diskriminieren anderer, Ausbeutung von Ungleichheit und das künstliche Schaffen dieser. Es besteht eine gewisse Widersinnigkeit darin zu glauben, dass eine Demokratie nicht in der Lage ist den politischen Islam zu bändigen, es aber mit der internen rechten Weltsicht schaffen könne.
Hier spiegelt sich auch die Tragik wieder, dass es heute eine gängige Strategie ist zu behaupten, man dürfe dies oder das nicht mehr sagen und dabei eigentlich nur keine Kritik an der eigenen geäußerten Meinung gehört werden will. Es ist ein Einfordern von Freiheit, die dem vermeintlich anderen verwehrt wird.
little Louis am Permanenter Link
Zu J. W. um 0:59 (zu spät in der Nacht) und :
J.W. sollte nicht vergessen, dass das Objekt rational- humanistischer Kritik an unkontrollierter Migration nicht das Individuum als Mensch ist, sondern vor allem dessen reaktionäre Ideologie , die man unweigelich mit importiert.
Ähnlich "naiv" hat man in der Weimarer Republik auch die Hitleranhänger beurteilt: Ungehobelte Rechtsproleten, denen man bei Regierungsbeteiligung schon die demokratischen Manieren beibringen können wird. Nix wars.
Religiöse Fundamentalismen oder auch nur nationalethnische "Traditionen" sind gefährlich verführerisch. Besonders in persönlichen und/oder ökonomischen Krisenzeiten.
Umfragen unter Migranten- Nachkömmlingen lassen schon jetzt eine in demokratietheoretischer Hinsicht gefährliche Indifferenz gegenüber "unseren" Grundwerten erkennen.
malte am Permanenter Link
"J.W.
Das ist Unsinn, und zwar sogar auf zwei Ebenen. Sobald Migration zum Problem stilisiert wird, wendet sich die Kritik IMMER gegen den Menschen als Individuum. Denn reaktionäre Ideologien sind ein Problem, völlig unabhängig davon, wo die Träger dieser Ideologien leben. Im Grunde ist genau das der Lackmustest, durch den sich emanzipatorische Kritik von reaktionärer "Kritik" (=Ressentiment) unterscheiden lässt: Wer die Migration in den Mittelpunkt seiner Kritik stellt, zeigt damit, dass seine "Islamkritik" lediglich vorgeschoben ist. Und eine "rational-humanistische Kritik an unkontrollierter Migration" kann es schon allein deshalb nicht geben, weil das Objekt der Kritik ("unkontrollierte Migration") gar nicht existiert.
little Louis am Permanenter Link
@ malte am 28.09.17 um 10:52
Wenn Sie das so glauben, kann ich auch nicht weiterhelfen. Ihr Wort in Gottes Ohr.
little Louis am Permanenter Link
@malte
Und es ist unfair, jemendem unlautere Motive bezüglich seiner Argumentation zu unterschieben, anstatt diese sauber zu widerlegen. ( Bin aber nicht beleidigt, da ich ich glaube, Ihre "Motive" zu kennen.) (-:
malte am Permanenter Link
a) "Deine Einstellung gefällt mir nicht."
b) "Ich will nicht, dass du in meiner Nachbarschaft wohnst."
Was unterscheidet diese beiden Sätze? Und welcher bezieht sich wohl auf Ideologie und welcher auf die Person? Wenn Sie diese Fragen beantwortet haben, wissen Sie auch, wieso Ihre Aussage unsinnig ist. Ich unterstelle Ihnen auch nicht unbedingt unlautere Motive. Vermutlich belügen Sie sich zuallererst selbst über Ihre Motive. Das ist allgemein viel häufiger der Fall als bewusste Täuschung.
little Louis am Permanenter Link
@ malte und zu Selbstäuschung
O.K. Dann muss ich wohl zu denen gehen, die mir zwei Metallröhren in die Hände drücken und mich von denen "clearen" lassen.Wenns nur nicht so ungeheuer teuer wär. Oder doch lieber bei "malte" beichten gehen? Ist wenigstens günstig und macht vielleicht sogar Spaß.
Denn Termine (für Therapien) bei Professionellen sind ja kaum zu kriegen.
Joachim Urlaub am Permanenter Link
Dies ist genau die Meinung wenn ich jeden Tag ARD und ZDF plus Bild Zeitung konsumiere. Leute es Zeit die Fakten wo anders zu finden.
Hubert Höfler am Permanenter Link
The big problems are : better social standards needed - building up the quick-internet connection for everyone in the whole Republik - and solving the problems of imigration (an imigration-law is needed / and schoolin
Yes - I'm a member of the Bündnis 90/Die Grünen - and so I voted per voting-LETTER on the first possible day here in Aichhalden, I think 10 days ago. -- Now the most possible constellation seems to be at the moment CDU/CSU/FDP/Greens, called "Jamaica" because of the party-colors "Black/Yellow/Green" of these political Partys. - This will be a very better parliament-constellation as the "Great-Coalition" in the past set together of CDU and SPD (Black/Red). -- My party, the GREENS, won a few voters of 0.7%.
We must do a better politic to stable the emissions of industrial production - and therefor the Greens are needed, thats good. -- Maybe my dream comes true, and in one or two years I can buy a good German ELECTRIC-DRIVEN-CAR who drives automatically from "A" to "B" by intelligent steering via electronic and satelite-navigation. -- That will be the future in the next 10 years !
Rainer Bolz am Permanenter Link
How dreadful.............
Johannes Müller am Permanenter Link
Zitat: ...Ganze 87 Prozent der Deutschen haben dies erkannt ....Das heißt aber auch, dass fast 70 % der Wähler!, nicht der Deutschen, eine CDU Regierung unter Merkel ablehnen und über 90 % erkannt haben, dass die Grün
webcruiser am Permanenter Link
Sie haben sehr schön kontrastierend die Kehrseite der statistisch belegten Argumente aufgezeigt.
Was man mit Statistik und Kombinatorik alles belegen kann, zeigt ein einfaches binäres dreistufiges Baumdiagramm zur (wahrscheinlich gebildeten) Koalition.
Da gemäß deutschem Wahlrecht keine Koalitionen explizit gewählt können, hat der Wähler nur die Möglichkeit, implizit durch seine Stimme gewisse Konstellationen zu bevorzugen oder zu verhindern.
Setzen wir das Ereignis
KG=(Koalition aus CDU, FDP, Grüne wurde implizit mitgewählt) und
KN=(Koalition aus CDU, FDP, Grüne wurde implizit nicht mitgewählt),
so ergibt sich durch Multiplikation entlang der jeweiligen Pfade folgendes Bild:
KG --> CDU—(32,9%)---FDP ---(10,7%)----Grüne(---8,9%) → 0,31%
KN --> CDU—(67,1%)---FDP ---(89,3%)----Grüne---(91,2%) → 54,6%
Das heißt im Klartext: 0,31% der Wähler haben implizit eine Jamaika Koalition mitgewählt und
54,6% haben genau diese Konstellation abgelehnt.
Oder noch deutlicher: 99,69% der Wähler haben sich implizit gegen eine Jamaika-Koalition entschieden.
Frei nach W. Churchill: Interpretiere jede Statistik so, wie es dir in den Kram passt!
Bruder Spaghettus am Permanenter Link
Woanders aufgeschnappt und für gut befunden:
Man muss sich doch einfach mal anschauen, wo die AfD Wähler herkommen. Über eine 1 Mio. ehemalige CDU Wähler, ne halbe Mio. ehemalige SPD Wähler, 400.000 ehemalige Die Linke Wähler, eine Mio. ehemalige Nichtwähler. Quelle: ARD. Und das waren alles Nazis vorher? Über den blauen Balken wundere ich mich kein Stück, die Medien und die etablierten Parteien haben für die AfD einen bomben Wahlkampf hingelegt. Ständig stand diese Partei in der öffentlichen Aufmerksamkeit, jede zweite Schlagzeile in der Süddeutschen, FAZ, Bild, Welt, Focus, Zeit, Tagesspiegel oder what ever war die AfD, die Beiträge immer inhaltsleerer, populistischer. Polittalkrunden fokussierten sich immer mehr darauf, die AfD auszugrenzen, anstatt sich auf Inhalte zu bestimmten Themen zu konzentrieren und darüber zu diskutieren. Die AfD war ständig omnipräsent, wir haben sie viel größer gemacht, als sie eigentlich sind, anstatt kühl und ruhig auf die Leute zuzugehen und ihnen mit Argumenten und Fakten im Diskurs gegenüber zu treten. Ausgrenzung wird dieses Problem nicht lösen, auf AfD Wähler einhämmern wird dieses Problem nicht lösen, alles und jeden, was mit der AfD zu tun hat, pauschal in eine braune Schublade stecken, wird das Problem nicht lösen. Man muss auf die Leute zugehen, ihnen zuhören und mit ihnen reden, nur dann werden sich Wähler zurückgewinnen und der AfD der Wind aus den Segeln nehmen lassen.
René am Permanenter Link
Wohl geschrieben. Nur ein Detail um der Redlichkeit Willen: Es waren 87 Prozent der *Wähler* und nicht 87 Prozent der Deutschen.
Sigrid Wiesendt am Permanenter Link
Zum aktiven und passiven Wahlrecht gehört auch die deutsche Staatsbürgerschaft, insofern können eben nur Deutsche wählen, das schließt ja nicht aus, dass Menschen aus anderen Herkunftsnationen, aber die deutsche Staat
René am Permanenter Link
Ich habe zunächst Deinen Einwand gar nicht verstanden. Mein Hinweis bezog sich lediglich darauf, dass 87 % der Wähler bei 76,2 % Wahlbeteiligung eben nur 66,3 % der Deutschen (im Sinne von Wahlberechtigten) sind.
Sabeth am Permanenter Link
Grundsätzlich stimme ich der Analyse zu, denke aber, dass sie den Aspekts des Gefühls der AfD-Wähler/-Gewählthabenden zu wenig berücksichtigt - es ist ein im Grunde psychologisches bzw.
Es geht darum, zu erkennen, dass das den Rechtskonservatismus kennzeichnet: All die oben genannten Gefühle, all dieses Überfordertsein von Komplexität, von Veränderung, daraus resultierend die Abwehr, das Rückwärtsgewandtsein, die Verweigerung, Neues, Fremdes zu-/einzulassen (in das eigene Denken, Fühlen, in das je persönliche Lebensumfeld ...).
Es widerspricht der linksliberale Gedanke der offenen Gesellschaft, der Gleichberechtigung, der Freiheit, der Dogmenferne ja gerade all dem, das Rechtskonservatismus ist und will.
Es geht darum, zu erkennen, dass das den Rechtskonservatismus kennzeichnet: all die oben genannten Gefühle, all dieses Überfordertsein von Komplexität, von Veränderung, daraus resultierend die Abwehr, das Rückwärtsgewandtsein, die Verweigerung, Neues, Fremdes zu-/einzulassen (in das eigene Denken, Fühlen, in das je persönliche Lebensumfeld ...).
Es ist keine Sache des Verstandes (der Intellekt wird - wie bei jeder Ideologie - nur als Vehikel, als Werkzeug, als Mittel zur Rechtfertigung und Verbreitung - eingesetzt), sondern des Gefühls der rechtskonservativ und rechtsextrem eingestellten, d.h. so fühlenden Menschen - und es gibt Ursachen für diese Gefühle, die eigentlich immer in der Kindheit zu finden sind, es gehen diese Gefühle auf die Prägung und Sozialisation der so eingestellten Menschen zurück, darauf, wie mit ihnen in ihrer Kindheit umgegangen wurde, w i e sie behandelt und schließlich auch indoktriniert wurden und das ganz gleich, wo auf der Welt Menschen reaktionär, "konservativ", autoritär, patriarchalisch "eingestellt" sind.
Wer eine Art Schwarze Pädagogik, wer keinen bedürfnisorientierten Umgang in seiner Kindheit erfahren hat, reagiert später im Leben entsprechend - mit Ängsten, Abwehr, mit diversen Störungen, Erkrankungen und Rechtskonservatismus ist meiner Überzeugung nach eine der möglichen Reaktionen/Folgen. Es mangelt solchen Menschen an Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Feinfühligkeit, Sensibilität und eben auch an Offenheit, Zugewandtheit, Selbstreflexion(svermögen), Differenzierungsfähigkeit ... .
Und bekannterweise befördern gerade all die repressiven, patriarchalischen Religionen, religiösen Praktiken (also auch eine entsprechende Erziehung) - gerade der drei monotheistischen, abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum/Katholizismus, Islam) - genau solche Gefühle und Einstellungen, die wiederum zu Konservatismus, Abwehr, Konkurrenz, Kampf, Gewalt, Unterdrückung führen.
Volkmar H. Weber am Permanenter Link
Das mit den 87 % der Deutschen, was so nicht richtig ist, erinnert stark an das Pfeifen im Wald oder wie auf Kirchentages skandierten wird: "Ihr seid wenige und wir sind Viele, aber der Liberalen Gott hat euch au
Limette am Permanenter Link
Grundsätzlich ist es nicht von der Hand zu weisen, es ist ein emotionales Problem, aber offenbar auf allen Seiten....warum sonst solche Hysterie?
Veränderung bedeutet ja nicht automatisch etwas positives! Wenn Politiker Verbände wie DITIB hofieren und ihnen Staatsverträge und Jugendarbeit anbieten, weil es der Integration und überfälligen Anerkennung diene, Verbände, deren Familien-Weltbild und Nationalismus und Abgrenzungsgedanken dem der Afd in Nichts nachsteht?!? und gleichzeitig die Wertvorstellungen der Konservativen als reaktionär, ewiggestrig, patriarchalisch abgewertet und dämonisiert werden, da fragt sich der gute Mittelschichtbürger, was hier gerade passiert und warum? Und wird vielleicht erst recht bockig, weil er sich herabgesetzt, verrascht oder erzogen sieht?
Jene konservativen Meinungen waren ja bislang sozial verträglich bei der CDU etc.geparkt, sogar bei den Grünen, wie man durch die Wählerwanderung sehen kann. Zu diesen konservativen Meinungen oder Lebenseinstelltungen kommt man ja nicht nur durch "schwarze Pädagogik". Sie dürfen auch sein, sie sind kein Mangel oder ein Erbegnis einer fragwürdigen Erziehung. So mancher kommt offenbar auch durch ein "linkes, offenes" Elternhaus dazu.
Offenbar ist der Identätsfaktor nicht zu unterschätzen. Er sorgt für Kooperation von größeren Gruppen, die eben keine genetischen Verbindungen haben, wie Familie.
Das kann sowas Verrücktes wie das rituelle Abschneiden einer Vorhaut sein, oder Fahnenkrempel, Nationalismus, alles was emotionale Verbindung triggert . Jeder Fußballverein arbeit damit.
Das wird man so schnell nicht lösen können. Schon gar nicht mit Dämonisierung und UNgleichbehandlung oder Abstrafung.
Sabeth am Permanenter Link
@Limette
Und es macht das "progressiv/liberal" Linkssein ja gerade aus, dass "Linke" dieses "Bedürfnis" nach Autorität, nach auch Nationalismus oder Patriotismus gar nicht haben. Ich denke schon, dass das eine Menge mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Reflexionsvermögen, Offenheit, Mitgefühl - mit also der jeweiligen Herzens- nicht nur Verstandesbildung zu tun hat und dass diese wiederum vor allem auf die jeweils erfahrene Prägung und Sozialisation zurückgeht, die wiederum auch Folge ist (dessen, das den Eltern indoktriniert wurde/wie sie erzogen, behandelt, geprägt wurden ..., dessen aber auch, das in einer Gesellschaft, in einem Land an politischen Verhältnissen, Normen gegeben/üblich/wirkmächtig ist - je autoritärer die Politik, umso gehorsamer die Staatsbürger - im Grunde zwangsläufig, da alles andere für sie mit erheblichen "Nachteilen" verbunden ist ...).
Erforderlich wäre m.E. vor allem eine globale Säkularisierung und eben auch Demokratisierung - hin eben zu offener Gesellschaft und zu Gemeinwohl(orientiertheit).
little Louis am Permanenter Link
Zu:
"Erforderlich wäre m.E. vor allem eine globale Säkularisierung und eben auch Demokratisierung - hin eben zu offener Gesellschaft und zu Gemeinwohl(orientiertheit)......"
(Zitatende)
Habe als junger "Altachtunsechziger" schon all das ( Damals halt der braun- christliche- Nationalkoservativismus) kritisiert und hätte mir damals kaum vorstellen können, dass 45 Jahre später selbst (angebliche) Linke sich zieren, gegen die aktuellen hardcore-Versionen all dessen vorzugehen. Selbst die damals in vielen Gegenden schon mächtigen Evangelikalen sind wieder im Aufwind. Und werden sich sicher irgendwann mit dem konservativen islamischen Mainstream arrangieren. Es gibt einfach zu viele Gemeinsamkeiten.Das erkennt ja auch schon "Die Storch" von der AfD. Auch konservative Katholen und Lutheraner schließen schon die Reihen.
Und nur nebenbei: Auch damals schon haben Interessierte die wirkmächtige Rassismuskarte gezogen. Z. B. bei Kritik an israelischer Hegemoniolpolitik. Und bei Kritik am Vietnamkrieg kam noch die "Kommunistenkarte" hinzu. (Geht doch rüber, ihr gottlosen antisemitischen Kommunisten (-:))
Das hat damals im Mainstream noch viel besser funktioniert, das es noch kein Internet gab und kaum einer wusste, dass auch "Nichtarier" (-: innerhalb und außerhalb Israels soche Kritik mitgetragen haben. Eine Headline in der Boulevarpresse hat ausgereicht, um die halbe Nation zu "programmieren"
Sabeth am Permanenter Link
@little Louis, ich habe kein Patentrezept ;) für bestehende Probleme, denke aber, wie oben ausführlich dargelegt, dass sehr vieles in der Kindheit angelegt wird und was wir bei religiös gläubigen Menschen (weltweit) f
Limette am Permanenter Link
Louis, vollste Zustimmung, vor allen Dingen in Frauenrechten....wie können Linke das auf einmal so entstellen???
Und nein, es ist nicht alles in der Kindheit begründet, es gibt noch viel mehr!
Sabeth am Permanenter Link
@Limette, vielleicht sollten wir uns zunächst darüber verständigen, welchen Begriff, welches Verständnis wir jeweils von politisch links"liberal"/-progressiv und "rechtskonservativ" haben.
Und was genau "entstellen" "Linke" (wer genau?) hinsichtlich der (welcher) Frauenrechte?
Limette am Permanenter Link
"Und es macht das "progressiv/liberal" Linkssein ja gerade aus, dass "Linke" dieses "Bedürfnis" nach Autorität, nach auch Nationalismus oder Patriotismus gar nicht haben."
nanu, da zeigt die Geschichte doch durchaus ganz anderes....links ist nicht automatisch "besser" und "rechts" nicht automatisch schlecht. auch hier muß diffenrenziert werden.
Und ganz wichtig, Kinder können obwohl sie in einer bestimmten Art und Wiese sozialisiert wurden, sich davon befreien oder darin beharren ...alles ist möglich.
Grundsätzlich stimmte ich natürlich zu:
Erforderlich wäre m.E. vor allem eine globale Säkularisierung und eben auch Demokratisierung - hin eben zu offener Gesellschaft und zu Gemeinwohl(orientiertheit).
Dennoch rate ich zur genauen Analyse, ein Standpunkt ist nicht automatisch schlecht, nur weil er konservativ ist. Schlecht ist , wenn er sogleich verdammt wird, weil er aus der konservativen Ecke kommt.
Ich lange Zeit nicht verstanden, daß links und rechts erst eine Mitte möglich machen, beide Extreme sind ohne Korrektiv ungenießbar.
Sabeth am Permanenter Link
@Limette, nun habe ich weiter oben hierauf bereits mittels eines Kommentars geantwortet, dort den Link zum blog einzufügen vergessen, daher nachfolgend.
http://kallisti-dichtet-belichtet.over-blog.com/2016/03/konservatismus-vs-liberalismus-worin-bestehen-die-unterschiede-zwischen-konservativen-und-liberalen-menschen-tatsachlich-und-was-hat
Limette am Permanenter Link
"Linksliberalismus" und "Rechtskonservatismus" ist nun auch eine enge Definition, es gibt ebeso "Linkskonservatismus" und "Rechtsliberalismus"
rainerB. am Permanenter Link
Was Sie zu Sabeths Kommentar geschrieben haben, ging mir bei dessen Lesen auch durch den Kopf. Danke, dass Sie sich schon die Mühre gemacht haben, die auch m.E.
Freddie50 am Permanenter Link
Wenn das die Sabeth Faber aus facebook ist, was vom Schreibstil her zu vermuten ist, sollte man das weder lesen noch kommentieren.
Sabeth am Permanenter Link
@Freddie50, ja, "es" ist Sabeth Faber aus fb, nein, sie hat (ich habe) nicht Psychologie studiert, sondern Philosophie, nein ich habe keinen Abschluss (machen können, was persönliche wie gesellschaftliche Gr
Nein, ein "Abschluss", ein Titel ist mitnichten ein zwangsläufiger Garant für Kompetenz oder Seriosität. Statt mich an dieser Stelle ausschließlich zu diskreditieren zu versuchen, sollten Sie zumindest den Versuch wagen, inhalts-/themenbezogen argumentativ zu reagieren - dies sei Ihnen in Ihrem Sinne nahegelegt.
Freddie50 am Permanenter Link
Oh, sorry, die einäugige Seherin ist eingeschnappt und fühlt sich diskreditiert.
Limette am Permanenter Link
Freddie50, natürlich kann ich antworten, warum auch nicht. Davon leben Debatten/Diskussionen.
Ich muß ihre Meinung nicht teilen und kann eine ganz andere vertreten.
Und mit solchen Zuweisungen " Psychotante mit Ergüssen" würde ich ja nun sehr vorsichtig sein. Alles Vermutungen. Nicht hilfreich, Kein Wissen. Lenkt vom Thema ab.
und klar, wenn man keinen Gewinn daraus schöpft, sollte man eben nicht antworten...warum dann aber dieser Beitrag? emotionales Abreagieren?
Jens Knobloch am Permanenter Link
Was beranlasst Sie, diese Partei als "christlich" zu bezeichnen?
In ihrem Selbstverständnis ist sie es selbst nicht.
Ich würde eher den Drang zu mehr Säkularisierung sehen.
Thomas Göring am Permanenter Link
@ Jens Knobloch
Dann lesen Sie mal die Grundsatzerklärung des christlichen "Pforzheimer Kreises" in der AfD: http://www.pforzheimerkreis.de/
Lesen Sie ferner den recht wohlwollenden Artikel in kath.net über das AfD-Parteiprogramm:
http://www.kath.net/news/58870
Und glauben Sie ernstlich, dass etwa die führende AfD-Politikerin Beatrix von Storch – stramm nationalkonservativ und(!) bekennend christlich – sich für "mehr Säkularisierung" einsetzen würde?
Siehe den äußerst wohlwollenden und sehr ausführlichen Artikel ebenfalls in kath.net über diese erzreaktionäre Dame: http://kath.net/news/46162
(Bitte den kath.net-Text sorgfältig lesen, um den Säkularisierungsplan dieser oldenburgischen Herzogin aufzudecken.)
Wer also, werter Herr Knobloch, projiziert hier in Wahrheit was wohin?
Kann es vielleicht sein, dass Sie als Christ die AfD ablehnen (wie es viele Christen bis "hinauf" zu den Kardinälen Marx & Woelki bekanntlich tun) - und Sie deswegen die Kombination des Namens "AfD" mit der Bezeichnung "christlich" nicht wahrhaben wollen? Dass also so etwas allein deshalb nicht sein darf, weil es Ihnen und etlichen Christen missfällt?
Wenn Ihre Augen genau hinsehen und Ihre Ohren genau hinhören wollen, so können Sie feststellen, dass zahlreiche Christen nicht das geringste Problem damit haben, sich in eben dieser AfD politisch beheimatet – vulgo: sich dort sauwohl – zu fühlen. Sind diese Leute deswegen etwa keine "echten" Christen, also bloß "falsche Brüder" (und Schwestern), die einem "anderen Evangelium" anhängen? Gehören die dann aus der wahren Gemeinschaft in Christo ausgeschlossen?
Jens Knobloch am Permanenter Link
Eine weitere Projektion: Ich bin also ein Christ.
Und danke auch für die umgangreiche Leseempfehlung.
Was lässt sie vermuten dass ich mir das durchlesen will?
Thomas Göring am Permanenter Link
Warum soll ich etwas auf Sie projizieren? Wenn Sie kein Christ, dann sind Sie eben keiner. Dann habe ich mich in Ihrem Falle eben insofern geirrt, schlimm?
Und woher bitte soll ich wissen, ob Sie meine Leseempfehlung denn auch beherzigen wollen? Eine Empfehlung ist eine Empfehlung; ob Sie diese annehmen oder nicht, das ist Ihre Sache und geht mich nichts weiter an.
Einen schönen Tag noch.
Wolfgang am Permanenter Link
Die beiden Großkirchen haben zu den Wahlen aufgerufen und geworben. Da ging der Schuss nach hinten los und jetzt ist großes Weinen angesagt. Tja, und keine Schutzengel weit und breit.
Roland Fakler am Permanenter Link
Die Angst vor der Islamisierung spielt bei AfD- Wählern sicher die wichtigste Rolle. Das Ganze hat aber auch einen „instinktiven“ Grund, deswegen spielen hier Argumente und Wahlprogramme überhaupt keine Rolle.
little Louis am Permanenter Link
Stimme der Analyse des "Chefideologe" im (gewohnt) angenehm klaren Stil weizgehend zu, habe allerdings auch zwei kritische Anmerkungen:
2. Zur MSS Aufzählung der Mitglieder der"Internationale der Nationalisten" (Andere sagen"Identitäre" usw.):
Wieder mal hat es der Philosoph nicht gewagt, auch die ethnisch-identitär Nationalkonservativen vom rechten Flügel der israelischen Gesellschaft (und Regierung) dazu zu zählen. Hat er etwa Angst, im linksliberalen und in Teilen des "linken" Lagers zu viel Aufruhr hervorzurufen?
Liegt er hier etwa ganz auf der Linie der Bundesregierung, die sich (zusammen mit Bulgarien?) dazu entschlossen hat , in die "neue" Empfehlung zur Definition des Begriffs einen Satz aufzunehmen, der auch Kritik an Israel als "Antisemitismus" deklariert ? Und das obwohl dieser Satz in der Entwurfsversion der Beteiligten Länder bzw. der Initiatoren offenbar NICHT enthalten war.
Nichts für ungut, aber man sollte auch als NICHT- Identitärer in der Gesamtargumentation "identisch" (bzw. intellektuell redlich oder auch konsistent) bleiben. Denn die Rechtsintellektuellen" bemerken soche "Eiereien" oder ein "Herumreden um den heißen Brei" sofort , da es ihnen erhebliche propagandistische Vorteile im Propagandakrieg verschafften könnte.
rainerB. am Permanenter Link
Punkt 2 sehr interessant! Muss ich glatt mal recherchieren, wie und auf was man sich da geeinigt hat.
little Louis am Permanenter Link
Nach einem Artikel in meiner Heimatzeitung vor ein paar Tagen war ich etwas "verwirrt", da dort der (letzte) Israelsatz nicht abgedruckt bzw erwähnt worden war und ich unsicher bin, wer ihm jetzt genau "
Wär schön, wenn Sie über ihre "Recherche" hier informieren könnten. Es gibt noch so viele andere "Baustellen" zur Zeit.
Gerhard KAHLERT am Permanenter Link
Ich frage mich immer wieder, ob eigentlich allen deutlich ist, was im Popperschen Sinne unter 'offener Gesellschaft und ihren Feinden' zu verstehen ist.
little Louis am Permanenter Link
Zuerst mal ein Rat zur Vorsicht: Man sollte beim Begriff "Offene Gesellschaft" nicht bei einem Mulitimilliardär und Spekulanten nachlesen, sondern bei Popper selbst.
Allerdings hat er immer klar betont, dass das Tolerieren von Intoleranz gleichbedeutend mit der Auslöschung bzw. dem Verschwinden der Vertreter der Toleranz sein könnte. Allein schon aus Gründen der (formalen) Logik.
rainerB. am Permanenter Link
"Weltoffenheit" - nun, die Neoliberalen haben dazu eine ganz klare Vorstellung: Kapitalverkehr ohne Grenzen, Standortpolitik ohne Grenzen.
Und Finanzspekulant Soros mit seiner Open Society Foundation(!) versteht unter Weltoffenheit konkret, dass z.B. Europa jährlich 1 Mio. Zuwanderer aufnehmen solle.
little Louis am Permanenter Link
@ rainerB
Vesuche möglichst geschickt und am besten verdeckt, deine Gewinne für dich zu behalten und deine Kosten und Verluste von allen Anderen mittragen zu lassen.
(Hat ein anderer vor mir schon kürzer gesagt, aberso gehts auch`(-:)
Kay Krause am Permanenter Link
Lieber Michael Schmidt-Salomon! Wie die meisten Ihrer Schreiblichkeiten spricht mir auch diese aus der (möglicherweise vorhandenen) Seele.
Theodor Ebert am Permanenter Link
Dass 87 % der deutschen Bevölkerung die AfD nicht gewählt haben, lässt die Wahlbeteiligung von 75 % unberücksichtigt. 12.6 % sind bezogen auf diese 75 % weniger als 10 %.
Sigmar Salzburg am Permanenter Link
MSS: „Man kann an diesen Ergebnissen erkennen, dass der Erfolg der AfD nicht zuletzt eine Quittung dafür ist, dass alle anderen Parteien die notwendige Debatte über den politischen Islam nicht hinreichend geführt, sch
Der Islam kann korangemäß auf Dauer nicht unpolitisch sein. Schmidt-Salomon stellt auch die bisherige Parteienpolitik falsch dar. Die Debatte wurde nicht nur „nicht hinreichend geführt“, sondern die Politiker lieferten sich geradezu einen Wettlauf um die Gunst der Moscheen. Dort predigte Sigmar Gabriel, ersehnte Nachrichtensprecherinnen mit Kopftuch und erinnerte Leute, denen das nicht gefiel, an Auschwitz.
Ungut ist auch die Wortwahl, die „AfD-Strategen haben diese Lücke geschickt genutzt.“ Damit wird ihnen die Unehrlichkeit unterstellt, eigentlich ganz andere Ziele zu verfolgen und das dumme Volk darauf reinfallen zu lassen.
Schließlich betätigt sich Schmidt-Salomon als Verschwörungstheoretiker: Finstere Fundamentalchristen benutzen die AfD-Wähler. Das soll er mal den ungläubigen Sachsen klarmachen. Auch atheisteistische AfD-Mitglieder oder Sympathisanten wie Nicolaus Fest, Michael Klonovsky, Imad Karim und sogar Thilo Sarrazin würden das gewiß zurückweisen.
Martin Winkler am Permanenter Link
Ein guter Kommentar mit zu starker Fokussierung auf die ungenügende Debatte etablierter Parteien über die notwendige Bekämpfung politisch islamischer Tendenzen.
agender am Permanenter Link
Es gibt immer GLEICHZEITIG ökonomische und emotionale Vektoren; wenn die krass gegensätzlich sind, wirken die, die das äussern, leicht lächerlich; aber bei einiger Übereinstimmung gibt es keine akzeptable Weise, die I
Wäre ein Übungsfeld für Sprachprofis!
Und wir müssen Die Linke sorgfältig beobachten (wollte das nicht im Wahlkampf sagen), da sie auch der Taktik religiöser Fanatiker (2 Gruppen!!!) ausgesetzt zu sein scheint - da war der Knackpunkt der Grünen (pers. Erfahrung)!!!
little Louis am Permanenter Link
Zu agender und:
"...Und wir müssen Die Linke sorgfältig beobachten (wollte das nicht im Wahlkampf sagen),.." (Zitatende)
Nix für ungut, aber das wurde auch hier (zumindest) in den vergangenen Jahren immer mal wieder angesprochen bzw. diskutiert. Aber offenbar hält man unter Partei- Wahlsrategen die religiöse Karte immer noch für mächtiger als die religionskritische und kirchenkritische. Oder man kann sich gegen die "Religionslinken" einfach nicht durchsetzen.
Mein Verschwörungsmodul merkt an, dass das auch ein von interessierten Kreisen bewusst gesetztes Tabu (oder "Steuerungsprogramm") sein könnte. Ähnlich dem Tabu, die Natomitgliedschaft in Frage zu stellen.
Ehrenfried Wohlfarth am Permanenter Link
gute und treffsichere Anlyse. Wollen wir hoffen, dass die etablierten Parteien die richtigen Schlüsse ziehen.
Wolfgang am Permanenter Link
Die Selbstherrlichen der CDU/CSU folgten dem Kurs ihrer "Kanzlerin" (ich habe nichts falsch gemacht!) und sie hat auch noch nichts begriffen.
ist eine unverschämte Antwort, die Frau Merkel auch von einer Teilnehmerin ins Gesicht geschleudert bekam. Es wird Zeit, das dieser Kusch-Kusch-Kurs beendet wird. Es ist aus,
denn "ihre Kinder" werden langsam erwachsen.
Dieter Weller am Permanenter Link
Ja ich bin einer der knapp 13% die AfD gewählt haben und bin zudem noch als Atheist aktiv.
Das ist kein Widerspruch!
Die Stärke der AfD beruht auf der Schwäche der anderen Parteien.
Schmidt-Salomon hat Recht, der Einzug der AfD in den Bundetag ist kein Weltuntergang.
Im Gegenteil er stärkt die Demokratie aus mehreren Gründen:
Nichtwähler in großer Zahl haben eine Alternative wählen können, alle relevanten Gruppen sind nun parlamentarisch vertreten, und es gibt in wichtigen Punkten wieder eine Opposition.
Das genau ist nämlich Demokratie!
little Louis am Permanenter Link
Was soll das für eine Opposition werden, wenn (bei den wesentlichen Punkten, wie der "Ökonomie) die SPD fast nur kritisieren kann, was sie selbst miterfunden und mitgetragen hat?(Neoloberalismustendenz)
Jochen Knödler am Permanenter Link
Ja, das sehe ich ähnlich.
Es geht nicht so sehr darum, dass das Thema "politischer Islam" zu kurz kam. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese zudem künstliche Unterscheidung zu einem sog. normalen Islam außerhalb akademischer Kreise irgend jemanden interessiert.
Nein, es geht darum: Massenhafte und unkontrollierte Migration aus bildungsfernen Armutsgebieten zerstört den Sozialstaat, missbraucht das Asylrecht, schwächt die innere Sicherheit. Ich denke, das war für die meisten AfD-Wähler der Hauptgrund, diese Partei zu wählen. Hinzu kamen Versuche, die AfD zu dämonisieren, sie als Nazi-Partei darzustellen. Das ist einfach nur dumm. Da sahen viele Politiker und Journalisten mit Parteibuch auch einfach ihre Felle davonschwimmen.
Mag sein, dass die AfD Positionen im Parteiprogramm hat, die nicht wünschenswert sind. Aber unkontrollierte Masseneinwanderung aus vorwiegend muslimischen Ländern ist das Letzte was eine offene Gesellschaft braucht.
Heinrich Zimmermann am Permanenter Link
Es ist schon wichtig, nicht einfach die "Bösen" gegen die "Guten" auszuspielen.
Wegdonnern ist somit das duemmste. Nehmt die Befuerchtungen ernst, denkt, denkt was Einwanderung bedeutet, Menschen die auch mehr wollen als ein Bett in einer Turnhalle. Die wollen auch Frau und ev. Kind. Meine Empfehlung: Ändert die Lebensumstände in den Herkunftsländer, nicht nur ausbeuten. Aber da sind Politiker auch ratlos, sie meinen der freie Markt regle das. Etc. Dabei ist das Religionsproblem noch nicht mal angesprochen.
little Louis am Permanenter Link
@ Heinrich Zimmermann am 27.9. um 22:26
Also niemend kann sagen, die Problematik habe ihn überrascht.
Johann Berger am Permanenter Link
Einseitig auf Religionskritik ausgerichteter Kommentar.
malte am Permanenter Link
Und wie genau wurde nun "die Meinungs- und Redefreiheit beschnitten"? Dafür können Sie nicht ein einziges Beispiel nennen. Alles nur hohle Phrasen.
Aber in einem Punkt haben Sie recht: Es ging den AfD-Wählern tatsächlich nicht primär um Religion, sondern um eine "abendländische Identität". Die Identitätspolitik, die Michael Schmidt-Salomon zu Recht kritisiert, funktioniert auch wunderbar ohne jede religiöse Fundierung. Will heißen: Teile des säkularen Spektrums müssen in diese Kritik eingeschlossen werden.
Oma13 am Permanenter Link
Guten Morgen,
wann verschwinden endlich aus Parteien und Wahlen das Religiöse, Religionen ?
Auch in Deutschland !
Andere Länder (z.B. Islam) verurteilen, Forderung bei Regierung : Trennung von Staat und Kirche.
Einfach lächerlich im 21. Jahrhundert auch in Deutschland : CDU und CSU, wobei
unsere Kirche nicht einmal zu ihren Schandtaten steht (z.B. Denef usw.).
Was läuft denn in Deutschland ?
Einzelne lokale Wahllokale (z.B. östliche Bundesländer) Auszählung der AfD -
jeder 3. wählte die AfD. Dafür finde ich keine Worte - nur Unverständnis über diese
Wähler.
Ich bin auch enttäuscht über unsere Regierung der letzten Jahre (Löhne Rente Schulen Bildung medizinische Versorgung u.v.m.) , deswegen würde ich trotzdem nie so eine Partei wie die AfD wählen.
Denn wir , die Bevölkerung Deutschlands wird immer wieder vergessen, welche großen Probleme dieses Land real hat !
Mag sein, dass unsere Außenpolitik von unserer Regierung einigermaßen gut geregelt wurde - die Probleme der deutschen Bevölkerung immer wiederkehrend gleich.
Frau Merkel und ich wurden 1961 eingeschult in den östlichen Bundesländern ,
was für verschiedene Wege...
Thomas Fiebig am Permanenter Link
Es gibt keinen explizit politischen Islam, mit dem man sich beschäftigen sollte. Religion in immer politisch. Wenn der Anteil der Muslime wächst, wird auch der Islam stärker.
Harald Schütz am Permanenter Link
Es wird zu wenig beachtet, dass es in der Bundestagsfraktion der AfD auch viele gemäßigte Leute gibt, deren Auffassungen man durchaus zustimmen kann.
Stephan Müller am Permanenter Link
Ich denke eher, dass alle anderen Parteien es versäumt haben, eine Utopie zu zeichnen, wie eine Gesellschaft in der Zukunft aussehen kann.
http://www.zeit.de/2017/40/afd-weimarer-republik-rechte/komplettansicht
PS: das war jetzt schnell aus dem Affekt zusammengeschrieben und nur sehr grob durchdacht. Nur schnell die Hauptpunkte meiner Gedanken in die Tastatur gehauen.
Thomkrates am Permanenter Link
Ein Trost ist mir der Kommentar ein wenig, aber mir ist auch bewusst, dass Trost täuschen kann.
Denn die etablierten Parteien allein haben es nicht - in der Hand, wie sie die 13 Prozent wieder reduzieren können. Denn anzunehmen, dass die etablierten Parteien die Lösung unserer Problem sind, ist ja ebenfalls eine kleine vorurteilsbelastete Eingenommenheit, die der Philosoph bitte auch zu diskutieren hätte. Es geht hier lediglich um das kleinere Übel, das zu tolerieren und zu aktzeptieren ist.
Denn sich auf die Etablierten zu verlassen, ist ja selbst eine gewisse unerwünschte Passivität, die ein freidenkender und freiempfindender im Angesicht unserer aller Begrenztheiten und Unzulänglichkeiten, im Blick haben sollte.
Aber es ist schon richtig: Wie denken in Perspektiven und befinden uns mal auf diesen mal auf jenen Ebenen der Betrachtung.